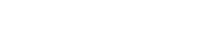Beiträge nach Tags
Jugendliche erobern die Gemeinderäte
Olivia Borer, Teamleiterin Gründungen und Support Jugendparlamente, DSJ
Die Gemeinderatssäle der Schweiz verjüngen und den Jugendlichen in ihrer Gemeinde eine Stimme geben – Das ist das Ziel der „Mission takeover!“, die im Jahr 2020 den Jugendparlamen-ten der Schweiz die Türen zu den Gemeinderatssälen öffnen sollte.

Dann kam COVID-19 und alles war etwas anders. Die Jugendparlamente waren aber nicht minder aktiv. So beteiligten sich neun Jugendparlamente in der Arbeitsgruppe zum Projekt und acht Takeovers wurden in ver-schiedenen Regionen der Schweiz umgesetzt oder sind noch geplant. Der erste Takeover geht dabei als festlicher Auftakt in die Jupa-Geschichtsbücher ein. Er fand mit 16 Jugendparlamenta-rierInnen im Ständeratssaal des Bundeshauses statt und wurde von keinem Geringerem als Ständeratspräsident Hans Stöckli begleitet.
2019 hat als Jahr der Milizarbeit erneut aufgezeigt, dass junge Erwachsene Mangelware im Schweizer Milizsystem sind, insbesondere in den Exekutiven. Das hat verschiedene Gründe – zu wenig Zeit auf-grund von Hobbies, der Arbeit oder der Familie, zu grosse Belastung bzw. Verantwortung oder zu wenig Wissen über die Politik oder den Bewerbungs- und Kandidaturprozess sind nur einige davon (Derungs und Wellinger 2019: 16). Deshalb wurde das Gespräch mit Jugendlichen und jungen Er-wachsenen gesucht und Diskussionsrunden zur Nachwuchsproblematik im Milizsystem anlässlich der Soirée Politique 2019 eröffnet. Zusammen kamen dabei über ein Dutzend Reformvorschläge für das Schweizer Milizsystem von Jungpolitikerinnen und Jugendparlamentariern. Kurz, Jugendliche haben Ideen, diese müssen nur gehört werden!
Ready, set, takeover!
Aus diesem Grund starteten der Bereich youpa sowie der Bereich Grundlagen Politische Partizipation GPP des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente im Jahr 2020 die „Mission takeover!“. Ziel ist es dabei, Jugendliche in ihren Gemeinden mit Gemeinderätinnen und -räten zusammenzubringen und in dieser Konstellation Reformvorschläge für das Milizsystem zu diskutieren. Die Jugendlichen über-nehmen dabei sinnbildlich den Gemeinderat und zeigen den Alteingesessenen, was sie sich wün-schen. So findet ein direkter Generationenaustausch statt und Nachwuchsprobleme im Milizsystem können an der Wurzel gepackt werden.
Neun Jugendparlamente meldeten sich für die Arbeitsgruppe und acht Takeovers wurden in verschie-denen Regionen der Schweiz in Angriff genommen. Die COVID-19-Pandemie hat zwar die Planung etwas unsicherer gemacht, dennoch wurde schon viel Arbeit geleistet und einiges konnte umgesetzt werden. Von Genf über Yverdon nach Bern und Luzern sind Takeovers in Gemeinden vorgesehen oder wurden bereits durchgeführt.
Die Gemeinde aktiv mitgestalten
Die Takeovers der Jugendparlamente sind dreigeteilt. Sie starten mit einem Vortrag zu ihren Wün-schen und Ideen für das Schweizer Milizsystem. Was müsste sich ändern, damit sie als junge Men-schen für den Gemeinderat kandidieren würden? Mangelt es für Jugendliche an der Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement? Und müssten die Dokumente für die Ausführung eines Amtes digital zur Verfügung stehen? Diese und weitere Fragen können von den Jugendparlamenten zu Beginn des Takeovers in einer Präsentation angegangen werden. Nach dieser sollen Mitglieder der Jugendparla-mente an einer Gemeinderatssitzung teilnehmen und sich zu Traktanden einbringen oder Rückfragen stellen können. Zum Schluss bietet ein informeller Austausch die Gelegenheit, weitere drängende Fra-gen anzusprechen. Die „Mission takeover!“ schafft es so, einen generationenübergreifenden politi-schen Austausch auf Gemeindeebene herzustellen und den Jugendlichen aufzuzeigen, dass sie die Politik in ihrem direkten Umfeld aktiv mitgestalten können.
Jugendliche „Übernahme“ des Ständerats und des Gemeinderats Brig-Glis
Der Auftakt zur „Mission takeover!“ fiel stattlich aus. 16 JugendparlamentarierInnen aus der ganzen Schweiz wurden am 7. September 2020 von Hans Stöckli im Bundeshaus in Empfang genommen. Die Jugendlichen löcherten den Ständeratspräsidenten mit Fragen und postulierten ihre Wünsche für ein zukunftsfähiges Schweizer Milizsystem. Auch in Brig-Glis stellten sich GemeindevertreterInnen wie Vizepräsident Patrick Amoos den Ideen und Wünschen der Jugendlichen. Aus beiden Anlässen resul-tierten wichtige Anliegen, die nun von den PolitikerInnen im Ständerat und auf Gemeindeebene weiter-verfolgt werden können, um das Milizsystem für Jugendliche attraktiver zu machen.
Nun bleibt zu hoffen, dass auch die weiteren motivierten Jugendparlamente noch die Gelegenheit erhalten, ihren Gemeinderat für einen Tag „zu übernehmen“ und die Sicht der Jugendlichen einzubrin-gen.
Literatur
Derungs, Cudrin und Dario Wellinger. 2019. PROMO 35. Politisches Engagement von jungen Erwach-senen in der Gemeindeexekutive – Analysen und Stossrichtungen. Chur: HTW Chur Verlag.
- Für weitere Auskünfte: Olivia Borer, Teamleiterin Gründungen und Support Jugendparlamente
- olivia.borer@dsj.ch
- Mehr Informationen: https://www.youpa.ch/angebote/jupa-projekt/2020-mission-takeover/
Beitrag teilen
Der Miteinbezug von Kindern und Jugendlichen: eine Win-win-Situation
Mona Meienberg, Child Rights Advocacy, UNICEF Schweiz und Liechtenstein
Der Miteinbezug von Kindern und Jugendlichen bedeutet, Kinderrechte umzusetzen und die Gemeinschaft als Ganzes zu stärken – eine Win-win-Situation
Den Gemeinden kommt in der föderalistischen Schweiz dabei eine besondere Bedeutung zu: Als direktes Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen stehen sie in der Verantwortung, ihnen ihre partizipatorischen Rechte zukommen zu lassen. Davon profitieren nicht nur die Kinder selbst, denn als aktive Mitglieder der Gesellschaft gestalten Kinder und Jugendliche diese massgeblich mit. UNICEF bietet den Gemeinden mit der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» ein Instrument, mit welchem sich eine Partizipationskultur auf kommunaler Ebene verankern lässt.
Partizipation verstehen
Das Partizipationsrecht von Kindern und Jugendlichen lässt sich direkt von der UN-Konvention über die Rechte des Kindes, kurz Kinderrechtskonvention, ableiten. Sie wurde 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedet und 1997 von der Schweiz ratifiziert.
Eines der vier Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention ist das Recht, angehört, beteiligt und informiert zu werden. Eine Reihe partizipatorischer Rechte rund um Artikel 12 der Kinderrechtskonvention gestehen Kindern und Jugendlichen ein umfassendes Mitwirkungsrecht zu. Doch was bedeutet es überhaupt zu partizipieren?
Zurecht sprechen Oser und Biedermann (2006) im Zusammenhang mit Partizipation von einem «Meister der Verwirrung». So haben alle ein anderes Verständnis von Partizipation und oftmals auch eine unterschiedliche Auffassung davon. Während die Partizipationsleiter von Roger Hart (1992) ein grosses Spektrum von Fremdbestimmung über Teilhabe bis hin zur Selbstverwaltung aufzeigt, wird unter dem Begriff der Partizipation gerade in der Anwendung oftmals lediglich das Einholen von Meinungen verstanden.
Da auch das Partizipationsbedürfnis von Kindern und Jugendlichen unterschiedlich ist, ist es wichtig, dass verschiedene Partizipationsformen und -gefässe bestehen. Während manche Kinder vor allem informiert werden möchten, wollen andere Kinder sich aktiv beteiligen und Prozesse mitgestalten oder sogar selbst verwalten. Des Weiteren beanspruchen manche Kinder ihre Meinungen und Bedürfnisse in einem institutionalisierten Rahmen, wie beispielsweise einem Kinder- oder Jugendparlament, anzubringen. Wieder andere Kinder ziehen es vor, sich anonym einzubringen.

Partizipation umsetzen und leben
Der rechtliche Rahmen ist gesetzt. Staaten, welche die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, sind verpflichtet, diese umzusetzen. Und somit auch die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Wenn man aber Kinder und Jugendliche befragt, sieht die Realität anders aus. UNICEF Studien wie beispielsweise «Von der Stimmung zur Wirkung» (2014) und auch die abschliessenden Bemerkungen des UN- Kinderrechtsausschusses von 2015 machen deutlich: in der Familie kann sich die Mehrheit der Kinder zu bestimmten Themen und Herausforderungen äussern, mitbestimmen und mitgestalten.
Anders sieht es jedoch aus, sobald das Kind im öffentlichen Raum auftritt. Gegenüber der Gemeinde haben Kinder und Jugendliche kaum Möglichkeiten, ihre Stimme zu erheben. Auch im schulischen Bereich besteht bezüglich der systematischen Partizipation noch Entwicklungspotential. Kinder verbringen einen Grossteil der Zeit in pädagogischen Institutionen. Entsprechend kommt den Schulen eine grosse Verantwortung in Bezug auf die Partizipation zu.
Diverse Gründe wie der personelle Aufwand, finanzielle Hürden, fehlendes Know-how oder kein ersichtlicher Nutzen führen dazu, dass Kinder und Jugendliche kaum Gestaltungsspielräume in unserer Gesellschaft erhalten. Kinder entwickeln, sozialisieren, integrieren und identifizieren sich aber über Räume und Projekte, von denen sie ein aktiver Teil sind. «Teil sein» sollen alle innerhalb der Gemeinschaft, ganz gleich ob Kinder, Seniorinnen und Senioren, Personen mit Beeinträchtigungen oder Migrationshintergrund. Nur so kann eine Kultur des Verständnisses, des Miteinanders und der Mitbestimmung entstehen.
Kinder als eigenständige Individuen und Rechtsträger sind aber darauf angewiesen, dass Erwachsene ihnen Zugänge und Gefässe schaffen. Zentral ist dabei, die Kinder und Jugendlichen in ihrer eignen Lebenswelt und mit ihrer Sprache zu erreichen. Eine Konfrontation und Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten aber auch Gefahren für Kinder und Jugendliche im digitalen Raum, den öffentlichen Räumen aus Kindersicht oder mit der Meinung von Kindern und Jugendlichen sind unumgänglich.
Gemeinden von zentraler Bedeutung
Kinder und Jugendliche leben in den Gemeinden. Diese bilden ihr direktes Lebensumfeld, in dem sie heranwachsen und sich entwickeln. Entsprechend wichtig ist es, dass Angebote und Massnahmen zum Schutz, zur Förderung und zum Miteinbezug von Kindern auf lokaler Ebene vorhanden sind. Das Mitwirkungsrecht lässt sich nicht nur direkt von der Kinderrechtskonvention ableiten, sondern schafft auch eine stärkere Identifikation mit der Gemeinde. Wer in einer bestimmten Sache angehört und involviert wird, setzt sich in der Regel auch stärker dafür ein und identifiziert sich in der Folge auch stärker damit.
Darüber hinaus wirkt sich die Partizipation von Kindern und Jugendlichen positiv auf deren Persönlichkeitsentwicklung aus. Kinder, die erleben, dass ihre Meinung erwünscht und auch berücksichtigt wird, entwickeln ein stärkeres Selbstbewusstsein. Sie erhalten dadurch eine bessere Ausgangslage, zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft heranzuwachsen, die für ihre Rechte einstehen können.
Der Miteinbezug von Kindern und Jugendlichen stärkte diese nicht nur, sondern es ergeben sich daraus auch Mehrwerte für die Gemeinde als Ganzes. In der föderalistisch organisierten Schweiz sehen sich gerade kleinere Gemeinden, welche im Milizsystem funktionieren, in Bezug auf die politische Nachwuchsförderung mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Kinder und Jugendliche zu befähigen und für die Politik zu begeistern bedeutet nicht nur, ihnen ihre Rechte zu zustehen, sondern kann auch dem Problem der Nachwuchsrekrutierung entgegenzuwirken.

UNICEF Initiative «Kinderfreundliche Gemeinden»
Um
Gemeinden bei der Umsetzung der Kinderrechtskonvention auf lokaler
Ebene zu unterstützen und dabei einen starken Fokus auf die
Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu legen, hat UNICEF die Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde»
entwickelt. Die Initiative hat die systematische Umsetzung der
Kinderrechtskonvention mithilfe eines standardisierten Prozesses auf
kommunaler Ebene zum Ziel.
Der Miteinbezug von Kindern und Jugendlichen ist ein verbindlicher Prozessschritt der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde». Eine Kinder- und Jugendpolitik auf Gemeindeebene ohne den aktiven Einbezug der Zielgruppe ist undenkbar. Im Rahmen der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» konnten direkt durch Workshops sowie indirekt mit Hilfe von Massnahmen zugunsten von Kindern und Jugendlichen bisher rund zehn Prozent aller Schweizer Kinder und Jugendlichen erreicht werden.
Da nicht alle Gemeinden Erfahrung mit der Partizipation von Kindern und Jugendlichen haben, ermöglichen verschiedene Förderfonds den Aufbau von Expertise in diesem Bereich sowie die Durchführung besagter Workshops. Während der Förderfonds von ALDI SUISSE die Planung und Durchführung von Workshops mitfinanziert, ermöglicht der Gemeindefonds der Stiftung Mercator Schweiz den Ausbau von Expertise und partizipativen Strukturen in den Gemeinden. Darüber hinaus besteht für eine Gemeinde über den Gemeindefonds auch die grundsätzliche Möglichkeit, Mittel für den Einstieg in den Prozess der «Kinderfreundlichen Gemeinden» zu erhalten.
Weitere Informationen zur Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» finden Sie unter www.kinderfreundlichegemeinde.ch oder per Mail an kfgncfch
Beitrag teilen
Gemeinsam ans Ziel mit Kindern und Jugendlichen
Lisa Radman, Projektmanagerin in den Bereichen Bildung und Mitwirkung, Stiftung Mercator Schweiz
Als Gesellschaft sind wir auf die Beteiligung und Mitbestimmung aller Menschen angewiesen – auch der Jüngsten. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Partizipation junger Menschen in Schule, Gemeinde oder Kita selbstverständlicher zu machen. Oft ist das Gelingen eine Frage der Haltung.
Eine Gesellschaft lebt von der Mitbestimmung der Bevölkerung. Neue und vielfältige Ideen und Meinungen finden Eingang in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse. Auf diese Weise kommt man auf bessere Lösungen für gesellschaftliche Fragen. Partizipation ist nicht nur für die Stärkung der Gemeinschaft, sondern auch aus individueller Perspektive wichtig: Bestimme ich mit und leiste meinen Beitrag zur Gesellschaft, fühle ich mich als Teil davon. Wer mitbestimmt, übt sich in einem respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Meinungen.
Frühe und dem Alter entsprechende Mitbestimmungsmöglichkeiten sowie positive Partizipationserfahrungen stärken Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu engagierten, kompetenten und verantwortungsbewussten Erwachsenen. Dabei profitieren nicht nur sie selbst, sondern alle Beteiligten sowie die Sache an sich. Es liegt an uns Erwachsenen, den Kindern und Jugendlichen diese Erfahrungen zu ermöglichen. Die Frage ist nur: Wie?
Partizipation – eine Frage der Haltung
Tatsächlich ist Partizipation gar nicht so schwierig. Ob sie gelingt, hat viel mit der Haltung zu tun: Bin ich wirklich an den Ansichten von Kindern und Jugendlichen interessiert? Möchte ich offen auf Kinder und Jugendliche zugehen und sie nach ihrer Meinung fragen? Bin ich bereit, ihre Meinungen anzunehmen und meine eigenen Ansichten zu überdenken? Wenn die Antwort darauf «nein» ist, sollte man lieber auf Partizipation verzichten. Denn «Scheinpartizipation» sorgt nur für Enttäuschungen und schadet mehr, als dass sie hilft.
Partizipation meint übrigens nicht, dass Kinder und Jugendliche bei allem mitentscheiden müssen. Es geht vielmehr darum, sie bei sie betreffenden Themen miteinzubeziehen und nicht über sie hinweg zu entscheiden. Zentral ist, von Anfang an deutlich zu machen, wer was wo mitbestimmen kann – und wo nicht. Der Schlüssel ist eine transparente Kommunikation vor und während des Prozesses. Eine externe Unterstützung beizuziehen, kann dabei helfen, Unsicherheiten beim Einbezug von Kindern und Jugendlichen zu begegnen. So können beispielsweise das Kinderbüro Basel, das Kinderkraftwerk oder auch Kinder- und Jugendarbeiter*innen vor Ort helfen.
Nachhaltiges Ergebnis
Partizipation ist ein Prozess. Und wie jeder Prozess, in dem man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, braucht Partizipation Zeit. Besonders, wenn es schnell gehen soll, schreckt der Aufwand viele ab. Doch die Ergebnisse partizipativer Prozesse sind meist nachhaltiger, weil sie von allen Beteiligten getragen werden. So zeigt sich, dass ein partizipativ geplanter Spielplatz plötzlich statt teure Spielgeräte ganz einfache Dinge wie Baumstämme zum Balancieren braucht. Littering findet im Park nicht mehr statt, weil die Jugendlichen diesen mitgestaltet haben. Eine grosse Eigenständigkeit der Kinder im Tagesablauf führt zur Entlastung vom Kitapersonal. Im Rahmen des Unterrichts halten sich Kinder an die selbst definierten Regeln und erinnern sich gegenseitig an deren Einhaltung. Sie lernen plötzlich besser, weil sie bei der Wahl der Aufgabe und der Sitzordnung im Klassenzimmer mitbestimmen durften. Es gibt bereits viele gute Beispiele, welche die positiven Effekte der Partizipation aufzeigen.
Partizipation in Gemeinden
Seit einigen Jahren setzt sich die Stiftung Mercator Schweiz dafür ein, dass die Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Sinne der UNO-Kinderrechtskonvention selbstverständlicher wird. Partizipation ist in allen Lebensbereichen möglich. Sogar bei den Jüngsten, in der Kita. Punktuelle Projekte bieten eine erste Möglichkeit, um mit dem Einbezug von Kindern und Jugendlichen Erfahrungen zu sammeln. Meist wird mit dem Einbezug bei der Umgestaltung von Räumen wie zum Beispiel dem Schulhaus, Spielplatz oder dem Dorfzentrum gestartet. Damit Kinder- und Jugendpartizipation eine Normalität wird, müssen sich jedoch die Rahmenbedingungen ändern und einen festen Raum für die Mitwirkung bieten.
Genau darum geht es in der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde». Möchte eine Gemeinde ihre Rahmenbedingen für Kinder und Jugendliche verbessern, kann sie sich in diesem Prozess von Unicef oder ihren Partner*innen in den Kantonen Zürich (okaj zürich) oder Graubünden (jugend.gr) begleiten lassen. Ausgangspunkt für den Prozess ist eine Standortbestimmung der Gemeinde. Basierend darauf bestimmt die Gemeinde, wo sie sich kinderfreundlicher und partizipativer aufstellen möchte und mit welchen Massnahmen sie dies erreichen kann. Das Vorgehen wird von externen Expert*innen beurteilt. Die «Kommission Kinderfreundliche Gemeinde» entscheidet über die Vergabe des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde». Anschliessend startet die Gemeinde mit der Umsetzung ihrer selbst gesetzten Ziele. Über den Gemeindefonds der Stiftung Mercator Schweiz können sich die Gemeinden beim Aufbau von Know-how, bei strukturellen Änderungen und den Labelkosten finanziell unterstützen lassen.
Die Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» bietet grosses Potenzial, um nicht nur eine punktuelle, sondern eine strukturelle Veränderung hin zu mehr Partizipation zu erzielen. Die Initiative ermöglicht es, dass Kinder und Jugendliche in ihrem täglichen Leben in der Gemeinde umfassendere und selbstverständlichere Mitbestimmungsmöglichkeiten erleben. Mehr Selbstverständlichkeit in der Partizipation ist wichtig. Denn es sollte keine Glückssache sein, ob Kinder und Jugendliche sich einbringen und mitbestimmen können.
Beitrag teilen
Partizipation mit Kindern und für Kinder – Machbar und dringend notwendig
Carlo Fabian, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit und Mitglied Scientific Committee der Child in the City Global Conference
„Kinder sind unsere Zukunft“ heisst es so schön immer wieder von allen Seiten. Solche Aussagen sind nur teilweise richtig, denn es ist nur die halbe Wahrheit; solch eine Sichtweise ist verengt, denn sie schreibt den Kindern für die Gegenwart keine bedeutende Rolle zu, gibt ihnen nur wenig Relevanz.
Kinder sind aber im Hier und Jetzt. Sie sind Gegenwart! Sie werden allerdings gesellschaftlich, sowohl strukturell als auch individuell, oft zu wenig wahrgenommen. Neben Bedürfnissen, Anliegen und Rechten haben Kinder oft viele für sie und die Gesellschaft allgemein gute und wichtige Ideen! Wir, die Gesellschaft, müssen daher Kinder verstärkt in allen zentralen Lebensbereichen integrieren. Das wird zwar bereits von vielen Organisationen und Menschen mit viel Engagement gemacht, dennoch braucht es eine weitere Stärkung. Das Ziel muss die Chancengerechtigkeit aller Kinder sein.
Das Recht auf Anhörung und Partizipation
Kinder in der Schweiz sind explizit von den klassischen demokratischen Mitgestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten wie Wahlen und Abstimmungen ausgeschlossen. Auf der anderen Seite heisst eines der vier Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention von 1989, die von der Schweiz 1997 ratifiziert wurde und damit verbindlich ist: «Das Recht auf Anhörung und Partizipation: Alle Kinder sollen als Personen ernst genommen und respektiert werden. Das heisst auch, dass man sie ihrem Alter gerecht informiert und sie in Entscheidungen einbezieht» (Quelle). Kinder, namentlich bei sie betreffenden Entwicklungen und Entscheidungen partizipieren zu lassen, ist deshalb nicht nur nett und progressiv, sondern auch ein Muss.
QuAKTIV: Kinderrechte, Partizipation und Umsetzung in die Praxis
Es gibt in der Schweiz sehr viele sehr tolle und gut gemachte Projekte, die sowohl die Kinderrechte, die Partizipation und das Wohlergehen der Kinder, inkl. Chancengerechtigkeit adressieren. Der Kanton Aargau hat vor ein paar Jahren ebenfalls ein entsprechendes Projekt lanciert.
Ausgangspunkt war, dass pädagogische, soziale (kindergerechte) und ökologische Anliegen im Kanton Aar¬gau zwar einzeln, aber kaum gemeinsam in einem Projekt umgesetzt wurden. Deshalb hat das Naturama Aarau in Kooperation mit verschiedenen kantonalen Fachstellen sowie mit Unterstützung der Stiftung Mercator Schweiz, die Fachhochschule Nordwestschweiz beauftragt, ein Projekt zu entwickeln, um die erwähnten Aspekte gemeinsam zu bearbeiten. So entstand das Programm QuAKTIV (2013-2016), ein umfassendes Programm, um mit Kindern und für Kinder ihre Freiräume gemeinsam zu entwickeln und zu gestalten. Grundlegende Anliegen und Werte von QuAKTIV waren die oben genannten Aspekte der Kinderrechte und Chancengerechtigkeit.
Umsetzung, Schlussfolgerungen und Learnings
Basierend auf dem Ansatz der Partizipativen Aktionsforschung als Rahmenmodell, wurde in drei Pilotprojekten mit lokalen Strukturen und den jeweiligen Stakeholdern in den Gemeinden (Kinder, Gemeindevertretungen, Schule, Jugendarbeit, Fachpersonen, etc.) sowie der Wissenschaft gemeinsam am Programm gearbeitet. Die Pilotprojekte sind in zwei Gemeinden und einem Stadtteil mit unterschiedlichen Umsetzungen, vielfältigen Entwicklungen und Ergebnissen sowie Erfahrungen und Erkenntnissen entstanden.
Unter anderem wurde deutlich, dass die Partizipation der Kinder umfassend, vielfältig und, eingebettet in einem Quartier- resp. Gemeindeentwicklungsprojekt, wertvoll war. Kinder konnten erfahren und lernen, dass sie sich einbringen können, ernst genommen werden, ihre Ideen und Anliegen aufgenommen und umgesetzt werden, und dass sie gemeinsam mit den verschiedenen Stakeholdern gemeinsame Lösungen suchen und mitgestalten können. Um die Projekte lokal nicht nur gut verankern, sondern auch, um sie gut organisieren und umsetzen zu können, war es entscheidend wichtig, kommunale Organisationsstrukturen zu schaffen. Konkret musste jedes Projekt eine lokale Projektleitung haben. Diese war in der Regel bei einer Gemeinderätin oder einem Gemeinderat angesiedelt. Eine lokale Arbeitsgruppe, unterstützt durch das Team der FHNW, hat die Prozesse strukturiert, die richtigen Fachpersonen mit ins Boot geholt und die Rahmenbedingungen für umfassende partizipative Prozesse mit den Kindern geschaffen. Die Schulen waren wichtige Kooperationspartner und Türöffner; die FHNW war verantwortlich für die partizipativen Prozesse und hat diese umgesetzt. Die wichtigsten Kooperationspartner waren die Kinder, die sich mit grösstem Engagement und viel Energie eingebracht haben.
Unter vielen Erkenntnissen war zentral, dass bei der Planung und Gestaltung von Freiräumen für Kinder es nicht nur darum geht, schöne und attraktive Freiräume zu schaffen. Der partizipative Prozess als solcher ist namentlich für die Förderung von individueller und sozialer Gesundheit sowie für die persönliche und lokale Demokratieentwicklung mindestens so wertvoll, wie die Nutzung dieser Räume dann. Zudem haben Erwachsene und Fachpersonen erfahren und gelernt, dass Kinder (ab 6 Jahren) gute und wichtige Kooperationspartner sind, und dass Kooperation, wenn im Gemeinwesen eingebettet, transparent geklärt und umsichtig geleitet, für alle gewinnbringend ist. Schlussendlich können Prozesse wie bei QuAKTIV auch zu einem Kulturwandel (Werte, Haltungen) hinsichtlich Partizipation in einzelnen Gemeinden beitragen.
Covid-19
Gerade in Zeiten der Covid-19 Pandemie (diese Zeilen werden am 6. April 2020 geschrieben), steht die Chancengleichheit der Kinder auf dem Prüfstand. Der Lockdown ist richtig, um die Pandemie zu verlangsamen. Homeschooling wird aber die Unterschiede der Bildungschancen zwischen den Kindern stark aufzeigen. Aber auch Belastungen und Gefahren betreffend Sicherheit und Gesundheit als indirekte Folgen der Covid-19 Problematik sind ungleich verteilt. Gerade auch in schwierigen Zeiten müssen die Kinder in Entscheidungen jeglicher Art explizit adressiert werden.
Hier finden Sie den Projektbeschrieb des Programms QuAKTIV
Hier finden Sie mehrere Informationen zu der Child in the City Global Conference
Beitrag teilen
Partizipation ist nicht besser - Sie ist wichtig!
Zeno Steuri, Leiter kinderkraftwerk.ch
In der Fragerunde zu einer Präsentation der partizipativen Schulhausplanung in Breitenbach, Kanton Solothurn, wurde ich gefragt, ob durch die Beteiligung der Schulkinder in der Schulhausplanung nun ein besseres Projekt resultiert, als wenn Architekten das geplant hätten.
Ich habe darauf geantwortet, dass diese Frage für die Beteiligten nicht relevant ist. Wichtig ist, dass sie als direkt Betroffene ihre Erfahrungen, Bedürfnisse und Ideen zur Raumplanung und Gestaltung für ihre neue Schule einbringen konnten und diese im Wettbewerb berücksichtigt wurden. Im Folgenden will ich aus der Praxis der Kinderpartizipation meinen Standpunkt erläutern.
Partizipationsverständnis
Bis heute habe ich nicht erlebt, dass Schulkinder die Beteiligung und Mitsprache bei einer Schulhausplanung eingefordert haben. Das mag viele Gründe haben. Meine These ist, dass Mitsprache geübt und auch erlernt werden muss, denn es ist ein demokratischer Prozess, der auch die Fähigkeit zum Konsens erfordert. Dazu braucht es auch Strukturen und Gefässe, in denen ein solcher Prozess den nötigen Raum hat. Den letztlich geht es auch immer die nötigen Ressourcen, Zeit und Geld. In der Schweiz stehen die Chancen gut, dass sich das einmal ändern könnte. Mit dem Lehrplan21 , welcher zurzeit landesweit in vielen Kantonen in einer Einführungsphase ist, sind die Zielsetzungen hinsichtlich Partizipation unter dem Postulat der Bildung für nachhaltige Entwicklung definiert:
«Wie eine Nachhaltige Entwicklung gefördert werden kann, hängt von den jeweiligen ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Verhältnissen in einem Land ab und muss gesellschaftlich ausgehandelt werden. Nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn sich Frauen und Männer, Junge und Alte an den Entscheidungsprozessen und an der Umsetzung der Entscheidungen beteiligen können.»
Wenn ich angefragt werde, mit dem KinderKraftWerk einen Beteiligungsprozess für Schulkinder zu organisieren, steht für mich eine Frage im Vordergrund: Ist gesichert, dass die Bedürfnisse und Ideen welche aus dem Beteiligungsprozess resultieren auch in der Umsetzung nach objektiven Kriterien berücksichtigt werden? Ist das nicht gewährleistet, macht Partizipation aus meiner Sicht wenig Sinn.
Wenn in der Schweiz ein neues Schulhaus gebaut werden soll, wird in der Regel ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Im Vorfeld dazu beauftragt die Gemeinde Fachleute um eine Bedarfsanalyse zu erstellen. Diese befragt Bildungsverantwortliche und zuständige Gemeinderäte zu ihren Bedürfnissen und Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen für die Zukunft. Daraus ergibt sich ein Raumbedarf, welcher in einem Baubeschrieb festgehalten wird. Das ist die eigentliche «Bestellung» der Gemeinde. Danach müssen sich die Architekten bei der Planung richten. Das Problem in diesem Prozess ist, dass die Kinder, welche einen grossen Teil ihrer Zeit in der Schule verbringen, nicht zu ihren Erfahrungen, Bedürfnissen und Ideen zur Raumplanung und Gestaltung befragt werden. Die Gemeinde Breitenbach wollte das ändern und hatte beschlossen, die Kinder bei der Erstellung des Baubeschriebs zu beteiligen.
Der Prozess der Beteiligung von rund 400 Schulkindern von der Kindergarten- bis zur Sekundarstufe erstreckte sich über 3 Monate und hatte drei Stufen:
- Begehungen und erfassen der Erfahrungen mit den bestehenden Schulanlagen
- Formulierung von Visionen für eine neue Schule
- Erfassung der Ideen in Zeichnungen, Modellen und Protokollen
Aus diesem Prozess entstand ein Bericht, der die Bedürfnisse an eine neue Schulanlage in Schwerpunkten zusammenfasste. Die Ergebnisse der Workshops zur Gestaltung der Innen- und Aussenräume wurden nach übereinstimmenden Mehrheiten gewichtet. Die Leitfragen waren:
- Wie erlebt ihr die Innen- und Aussenräume eurer Schule?
- Was macht ihr wo?
- Was könnt ihr nicht machen?
- Was würdet ihr anders gestalten und warum?
Im Vordergrund standen immer Aktivitäten und Abläufe im Schulalltag, die eine Ursache in der Gestaltung haben. Aus den Ergebnissen konnten wir ablesen, was die Architekten in der Gestaltung und Raumplanung berücksichtigen mussten.
Die Beteiligung am Mitwirkungsprozess wurde zum Gesamtprojekt der Schule und Teil des Unterrichts. Die Erziehungsberechtigten wurden dazu im Vorfeld schriftlich informiert. Waren sie oder ihre Kinder mit diesem Bildungsinhalt nicht einverstanden, bestand die Möglichkeit dem Regelunterricht in einer Parallelklasse zu folgen, da die Workshops zeitlich abgestuft stattfanden.
Soweit so gut. Doch was waren die Ergebnisse dieses Beteiligungsprozesses? Einige Beispiele:
Raumplanung
Ein Vorschlag der Vorstudie zum Architekturwettbewerb war, die Primarschule mit dem Kindergarten zu einem Schulhauskomplex zusammen zu legen. Wir haben diesen Vorschlag auch den Schülern vorgelegt. Aus Erfahrung wussten sie, dass das keine gute Idee ist, weil die zwei Schulstufen unterschiedliche Tagesabläufe hatten. Spielende und schreiende Kindergartenkinder auf dem Pausenhof, während die Primarschule sich auf einen Test konzentrieren muss – geht gar nicht. Im Modell zeigt eine Gruppe Primarschulkinder wie sie das Problem mit einem Schulgebäude mit zwei unterschiedlichen Eingängen und Pausenhöfen lösen würden. Die Architekten kamen zum Schluss, dass es zwei Baukomplexe mit bedürfnisgerechter Gestaltung werden mussten. Das haben auch die Lehrpersonen, die wir in einem separaten Workshop befragt haben, sehr begrüsst.
Aus dem Beteiligungsprozess mit den Schulkindern sind über 30 Teilprojekte im Aussenraum entstanden, die meist in eigener Regie von den Lehrpersonen mit den Schülern realisiert werden. Partizipation wurde in Breitenbach zum Imperativ! Für den Neubau mussten dutzende Bäume unterschiedlicher Grösse und Art gefällt werden. Auf Empfehlung der Landschaftsarchitekten wurden diese eingelagert und für Möblierungen im Aussenraum aufgehoben. Im Werkunterricht werden daraus Schneidebretter, Zaunlatten für den Kindergarten, Balken für ein Chill-Pavillon, Teile für Sitzelemente, welche die Sekundarschule in Zusammenarbeit mit einem Künstler gestaltet du vieles mehr.
Innenräume
Auch die Schulgebäude der KTS, welche in Breitenbach erhalten bleiben, werden nach den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler umgebaut. So erhalten alle Schüler endlich einen eigenen Spint und die trostlosen Flure werden farbig gestaltet und mit gemütlichen Sitzgruppen ausgestattet, die sich die Schüler im Brockenhaus selber besorgen dürfen. Aus einer ehemaligen Abwartswohnung wird ein zentral gelegenes Lehrerzimmer, das für alle schnell und leicht erreichbar ist. Ein grosser Wunsch der Lehrpersonen und Schüler. Auch ein Fahrstuhl für Kinder mit einer Behinderung fand Platz und ermöglicht einen Barrierefreien Zugang. Die neue Primarschule wurde mit abwechslungsreichen Verkehrsflächen und Arbeitsnischen gestaltet. Die Wände sind für grossflächige Panels vorgesehen, die ebenfalls von den Schülern im Werkunterricht gestaltet werden und von kommenden Schülergenerationen wieder erneuert werden können.
***
In Breitenbach steht heute eine neue Schule, mit der sich die ganze Gemeinde identifiziert. Das wurde schon bei der Grundsteinlegung deutlich die überraschend gut besucht war. Allen ist klar, dass eine Schule ein Zweckbau ist und einen optimalen Schulbetrieb Garantieren muss. Dass es nun auch ein lebensfreundlicher Raum wird, ist der Gemeinde zu verdanken, welche den Mut hatte, zuerst die Kinder zu befragen, bevor sie den Architekten den Auftrag erteilten. Ermutigen sie die Verantwortlichen an ihrem Wohnort es ihnen gleich zu tun. Die Kinder werden es ihnen danken!
Beitrag teilen
Zwischen Institutionalisierung und Rebellion – Jugendpolitik damals und heute
Zwischen Institutionalisierung und Rebellion – Jugendpolitik damals und heute
Simon Eggimann, Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ)
Jugendpolitik ist nicht gleich Jugendpolitik. Schon immer befand sie sich im Wechselspiel von Institutionalisierung und Rebellion. Manchmal stand das eine im Vordergrund, manchmal das andere. Der Applaus und die Zurufe waren mal lauter, mal leiser. Es ist wie bei einem Tanzbattle. TänzerInnen sind gekommen und gegangen; zwischendurch hat sich der Beat verändert; mal wurden die wildesten Solos hingelegt und dann ging es wieder ruhiger zu und her. Aber nie fehlte komplett die Puste oder die Inspiration. Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ mischt nun bereits seit 25 Jahren in diesem Battle der Jugendpolitik mit. Es ist deshalb höchste Zeit, auf die auffälligsten Tanzschritte zurückzuschauen.

Der Tanz wird eröffnet
Ein erstes Mal zum jugendpolitischen Tanz gebeten wurde in Bern bereits sehr früh, nämlich mit der Entstehung des „Äusseren Stand“ im Jahre 1732 . Unter diesem Namen versammelten sich bis zu 150 Söhne von Patriziern. Obwohl alle über 18 Jahre alt waren, bildeten sie eine Art institutionalisiertes Jugendparlament. Gleichzeitig trafen sich die weniger aristokratischen Jünglinge regelmässig zum sogenannten Schüsselikrieg. Es handelte sich dabei um ein Scheingefecht, während dem die militärische Verteidigung der Stadt geübt wurde. Einmal im Jahr zog deren neu gewähltes Regiment durch die Gassen und der „Äussere Stand“ erwies ihm die Ehre. Ein erstes Mal existierten also die klar strukturierten und die lauten Jungen nebeneinander.
Danach ebbte der Tanz zu einem scheuen Fusswippen ab. Der Beat ging aber, dank in kleinem Kreis politisierenden Burschenschaften, nie ganz verloren. Das Aufkommen des Begriffs „Jugend“ im 19. Jahrhundert brachte schliesslich neue Rhythmen hervor. Jugendpolitik war nun nicht mehr als „für“, sondern „von“ der Jugend zu deuten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war diese noch sehr konventionell, es entstanden erste karitative oder paramilitärische Jugendverbände wie Pro Juventute oder die Pfadfinder. In der Zwischenkriegszeit kamen dann die ersten Jungparteien dazu.
Lebendige Tanzeinlagen der Jugendbewegungen
Schliesslich bildeten sich nach 1945 Jugendbewegungen, die sich für die Schaffung von Jugendhäusern und -zentren einsetzten und sich mit Mode, Musik und Medien von den Erwachsenen abgrenzten – es entstand eine jugendliche Subkultur. Fast gleichzeitig – nämlich 1948 – fanden 27 Jugendparlamente zur Vereinigung Schweizer Jugendparlamente (VSJP) zusammen. Es folgte ein Auf und Ab mit einer Auflösungswelle in den 1950er-Jahren und zahlreichen Neugründungen im nächsten Jahrzehnt, die in der Etablierung des Schweizer Jugendparlaments (SJP) gipfelten.
Die Jugendbewegungen wurden in den 1960er Jahren vermehrt politisch. Der Tanzstil wurde aggressiver und der Platz wurde für die konventionellen Akteure enger. Die 68er-Bewegung prägte, wie keine andere vor ihr, eine gesamte Generation. So konkurrenzierte sie auch die Jugendparlamente und führte dazu, dass deren Ära vorübergehend zu Ende ging.
Zurück zum Standardtanz?
Während der Kalte Krieg eher durch eine turbulente Jugendpolitik geprägt war und die Jugendunruhen in den 1980er Jahren nochmals aufloderten, fand seit 1991 eine Rückkehr zu institutionalisierterer Jugendpolitik statt. Zwanzig Jahre nach der schweizweiten Einführung des Frauenstimmrechts wurde das nationale Stimm- und Wahlrechtsalter in der Schweiz von 20 auf 18 Jahre gesenkt.
Ebenfalls 1991 fand erstmals die Jugendsession der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV im Bundeshaus statt. 1993 trafen sich dann verschiedene Jugendparlamente und -räte zur ersten Jugendparlamentskonferenz (JPK). Beide Formate bewährten sich und werden bis heute von zwei unterschiedlichen Organisationen weitergeführt. Der DSJ wurde anlässlich der dritten JPK am 4. November 1995 gegründet und war in den folgenden 15 Jahren ein kleiner Jugendverband, der jährlich die Delegiertenversammlung, die JPK und teilweise auch ein Präsidententreffen sowie Seminare durchführte. Daneben publizierte der DSJ das Magazin „Der Elch“ sowie Broschüren zu den Jugendparlamenten und es formierten sich Arbeitsgruppen zu verschiedenen politischen Themen.
Zwischen 2007 und 2009 sank die Anzahl der Jugendparlamente auf gerade noch 36 und der DSJ sah sich gezwungen, neue Moves auszupacken, um auf der Tanzfläche zu bleiben. Mit einer ersten Dreijahresstrategie ab 2011 und der Übernahme des Projekts easyvote , das vom Jugendparlament Köniz gegründet und einige Jahre von Jugendparlamenten aus dem Kanton Bern weitergeführt worden war, war der DSJ warmgelaufen und bereit für die nächste Runde. Ab 2011 stiegen die Leistungen sowie der Personalbestand kontinuierlich an und der Umsatz verzehnfachte sich innerhalb von sechs Jahren. Durch die Einführung einer professionellen Geschäftsstelle konnte diese die operativen Tätigkeiten vom Vorstand übernehmen und der Vorstand kann sich seitdem auf seine strategischen Aufgaben fokussieren. 2015 ging zusätzlich die Plattform engage.ch online und ab 2018 wurde der Bereich Grundlagen Politische Partizipation aufgebaut.
Alleine tanzen wäre langweilig
Während es nun lange Zeit eher ruhig und gesittet zu und her ging, und einige bereits über unsere apolitische Jugend lamentierten, bringen die Klimastreiks seit 2019 neue Dynamik in die Jugendpolitik. Es handelt sich dabei um die grössten Jugendproteste der Schweizer Geschichte. Auch in Bezug auf Häufigkeit und Dauer hat sich seit den 1980er Jahren keine so aktive Bewegung mehr formiert (SRF, 2019). Verdrängt diese Massenbewegung nun jegliche etablierten Institutionen der Jugendpolitik? Und müssen die Jugendparlamente erneut um ihre Existenz bangen?
Der DSJ ist heute sehr breit aufgestellt und kann unterschiedlichste Bedürfnisse abdecken. Eher auf der klassischen Seite stehen die Jugendparlamente selbst oder die Informationen zu Abstimmungen und Wahlen von easyvote. Gleichzeitig gibt es aber auch weniger institutionalisierte Formen der politischen Mitwirkung wie beispielsweise die digitale Partizipation auf engage.ch oder das Engagement im Civic Tech-Bereich. Bisher haben die Entwicklungen rund um die Klimastreikbewegung aufgezeigt, dass auch ein Neben- und Miteinander von institutionalisierter Jugendpolitik und grossflächig mobilisierten Jugendbewegungen möglich ist. Und wieder kann das Tanzbattle als Vergleich hinhalten: Nur der Wettbewerb macht es für TänzerInnen und ZuschauerInnen spannend und verschafft ihm die nötige Aufmerksamkeit. Also tanzen wir weiter und stärken somit gemeinsam die Jugendpolitik.
Simon Eggiman, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Grundlagen Politische Partizipation, DSJ (Dachverband Schweizer Jugendparlamente), info@dsj.ch
Quellen:
• Stadtwanderer (Claude Longchamp), 2020. Stadtwanderung „Jugend&Politik“.
• SRF, 2019. Animation: So hat die Klimajugend demonstriert.
Fokus Kinder- und Jugendpartizipation
Fokus Kinder- und Jugendpartizipation
Welche Möglichkeiten haben Kinder und Jugendliche, sich an Politik und Gesellschaft zu beteiligen? Welche Bedeutung wird ihrem Engagement und welches Gewicht wird ihrer Stimme beigemessen, im Allgemeinen und in den Bereichen, die sie direkt betreffen? Und wie kann die Partizipation von Kindern und Jugendlichen gefördert und verbessert werden? Die neue Themenrubrik von in comune widmet sich diesen und weiteren Fragen.
Gemäss Bundesamt für Statistik ist ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung zwischen 0 und 19 Jahre alt (Stand 2019) und gehört damit zur Kategorie «Jugendliche» gemäss den Statistiken zur Bevölkerung in der Schweiz. Die Kinder- und Jugendpolitik wird von verschiedenen Akteuren mitbestimmt, liegt aber in erster Linie in der Verantwortung von Kantonen und Gemeinden.
Wer über Jugendpartizipation spricht, denkt in erster Linie an die Teilnahme am politischen Leben. Diese wird durch das Stimm- und Wahlrecht ermöglicht. In der Schweiz darf man auf Bundesebene ab 18 Jahren abstimmen und wählen (bis 1991 wurden das Wahl- und Stimmrecht erst mit dem Erreichen des 20. Altersjahres verliehen). Bei kantonalen und kommunalen Abstimmungen steht es jedem Kanton frei, die Altersgrenze zu senken. Bisher hat nur der Kanton Glarus diesen Schritt unternommen: Seit 2007 können Glarnerinnen und Glarner ab 16 Jahren abstimmen (Wahlrecht ab 18 Jahren). In verschiedenen anderen Kantonen – z.B. Waadt, Zürich, Bern und Neuenburg – wurden Vorschläge zur Senkung des Stimmrechtalters gemacht, sie blieben aber allesamt erfolgslos.
Das Stimmrechtalter ist Gegenstand einer hitzigen Debatte, die interessante Denkanstösse über das Funktionieren der Demokratie sowie über die Frage der gemeinsamen Verantwortung liefert. Während auf der einen Seite oft die mangelnde politische Partizipation der jüngeren Wählerinnen und Wähler hervorgehoben wird, können auf der anderen Seite Ereignisse wie die jüngsten Jugenddemonstrationen gegen den Klimawandel als Bereitschaft der Jugendlichen interpretiert werden, sich an der Politik zu beteiligen, ihre Meinung zu äussern und ihren Teil der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen.
Die politische Bildung ist für die politische und soziale Partizipation der künftigen Stimmbürgerinnen und -bürger von grundlegender Bedeutung. Die Hauptrolle in diesem Bereich hat die Schule. Sie muss Kindern und Jugendlichen die Grundlagen der politischen und institutionellen Struktur des Staates vermitteln.
Die Jugendparlamente (die auf in comune bereits vorgestellt wurden), sind für Jugendliche eine gute Möglichkeit, sich der Politik anzunähern. Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ fördert die politische Partizipation von Jugendlichen z.B. durch das Programm easyvote und das Projekt engage.ch. Die Jugendsession wurde 1991 gegründet und wird vom Bund im Rahmen des Gesetzes über die Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung unterstützt. Sie wird vom Schweizerischen Dachverband für Jugendorganisationen SAJV organisiert und bietet jährlich 200 Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren die Möglichkeit, ihre Anträge den Parlamentarierinnen und Parlamentariern im Bundeshaus vorzustellen. Für die Jüngeren existieren auch Kinderparlamente: Ein gutes Beispiel dafür ist das Kinderparlament (8 bis 14 Jahre) in der Stadt Bern, das jährlich zweimal tagt.
Wenn man das Thema breiter analysiert und über die politische Partizipation hinausgeht, zeigt sich, dass es viele Möglichkeiten gibt, Jugendliche und Kinder auf kommunaler und kantonaler Ebene in das gesellschaftliches und politisches Leben einzubeziehen. Eine Vielzahl von Fachleuten – u.a. Kinder- und Jugendarbeiter und Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen, Forscher und Forscherinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen – fördern und unterstützen solche Möglichkeiten der Partizipation.
Zu erwähnen sind auch die Initiativen von Verbänden und Organisationen, welche die Partizipation von Kindern und Jugendlichen fördern. Die UNICEF-Initiative für das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» fördert z.B. Prozesse, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen in der Gemeinde aus Sicht der Kinder zu verbessern und unterstützt somit die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf Gemeindeebene. Art. 12 dieses Dokuments, das die Schweiz im Jahr 1997 ratifiziert hat, erklärt das Recht der Kinder, ihre Meinung zu äussern und gehört zu werden. Dies ist gleichzeitig ein Prinzip der Partizipation: Zuhören und die Meinung von Kindern und Jugendlichen zu anerkennen, bedeutet, ihnen das Recht auf Partizipation zu geben. Dazu gehört auch, ein gewisses Mass an Verantwortung zu gewähren und umgekehrt zu übernehmen – ein wichtiger Faktor für die eigene Entwicklung und für das Verständnis des eigenen «Platzes» in der Gesellschaft.
In der neuen Themenrubrik erhalten die oben genannten Überlegungen einen breiten Raum. Expertinnen und Experten des Bereichs «Kinderpartizipation» stellen Projekte vor, die nur dank dem Einbezug der Ansichten von Kindern realisiert werden konnten. Die Beiträge zeigen zudem Folgendes: Indem die Ideen von Kindern mit denjenigen von Erwachsenen kombiniert werden, können Projekte weiter verbessert werden.
Wir wünschen Ihnen eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre und danken allen, die zur Realisierung dieser Rubrik beigetragen haben!
Digitale Mitwirkung in der Praxis: Mehr Planungssicherheit und Effizienz erreichen
Miro Hegnauer, E-Mitwirkung
Öffentliche Vorhaben sind oft vielschichtig und komplex. Prozess- und Planungssicherheit sind grosse Herausforderungen. Ein früher Einbezug der betroffenen Anspruchsgruppen wird immer wichtiger.
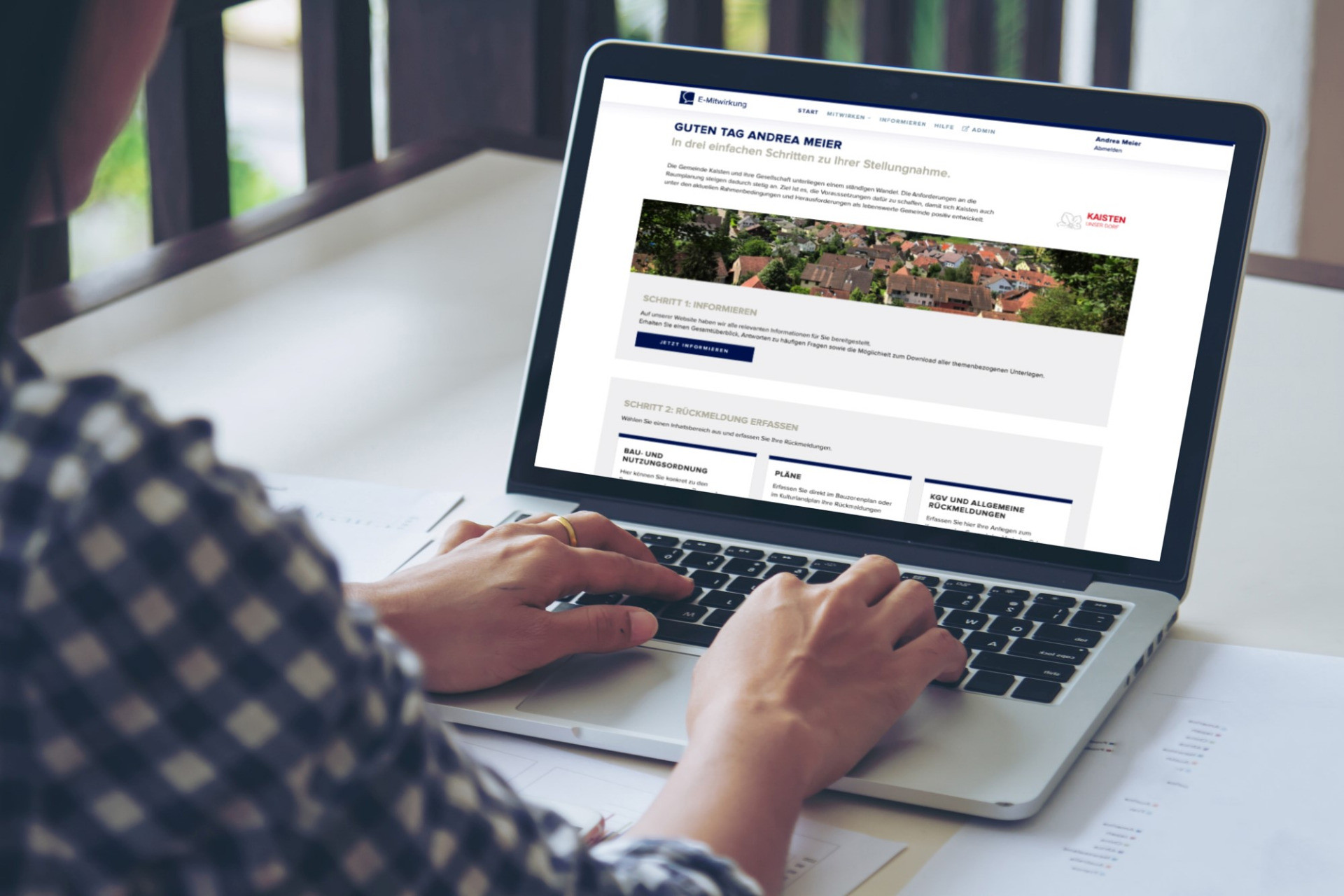
Mit dem Einsatz einer digitalen Mitwirkung kann die Vorhabens-Umsetzung für die Verwaltung sicherer und effizienter gestaltet werden. Der Einsatz einer digitalen Lösung ist mittlerweile keine «Zukunftsutopie» mehr. Bereits eine Vielzahl von Gemeinden, Städten und Kantonen setzen auf den digital unterstützten Prozess.
So auch die Gemeinde Suhr beim Vorhaben «Kommunaler Gesamtplan Verkehr». Ziel war es, die Bevölkerung frühzeitig zu integrieren und ein Verständnis für das komplexe Thema zu schaffen. «Mit der digitalen Mitwirkung konnten wir mit der Bevölkerung in einen Dialog treten, Stärken und Schwächen erkennen und diese gezielt in der Planung berücksichtigen», so Marco Genoni, Gemeindepräsident von Suhr.
In der Stadt Solothurn halft der digital unterstützte Prozess bei der formellen Mitwirkung der Ortsplanung, die Vielzahl von Stellungnahmen effizient und effektiv einzuholen und auszuwerten. Über die integrierte, digitale Informationsplattform konnte sich die Bevölkerung zudem laufend über das Vorhaben informieren. «Die Online-Plattform half uns, die komplexe Thematik verständlich und akzeptanzfördernd zu kommunizieren.» erläutert Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamtes.
Was ist die Herausforderung bei der Durchführung von digitalen Mitwirkungen? «Partizipation bedingt Information. Eine gut begleitende Kommunikations- und Informationsführung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.» erklärt Miro Hegnauer, Anbieter der digitalen Gesamtlösung «E-Mitwirkung».
Löst die digitale Mitwirkung klassische Partizipationsformen ab? «In unseren Projekten sehen wir die digitale Mitwirkung als optimale Ergänzung zur Offline-Partizipation. Sie hilft, zusätzliche Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Die Teilnehmenden schätzen besonders die orts- und zeitunabhängige Erfassung», so Josua Schwegler, Raumplaner bei der PLANAR AG.
Die digitale Mitwirkung ist eine Chance für die Gesellschaft als auch für die Verwaltung. Weg von einer «Ja / Nein Demokratie», hin zur echten Partizipation. Die Verwaltung erhält frühzeitig Rückmeldungen und kann dadurch zielgenauer arbeiten, dies erhöht die Planungssicherheit schafft Effizienz-Vorteile, dies mitunter einer erhöhten Automatisierung.
Miro Hegnauer, Geschäftsführer Konova AG und Projektberater E-Mitwirkung.
Dieser Beitrag ist in der März-Ausgabe der «Schweizer Gemeinde» erschienen.
DigiLoge Bedürfniserhebung
Lorenz Kurtz, PLANVAL
Wie digitale Tools beitragen, die Bedürfnisse der Bevölkerung in Erfahrung zu bringen und zu motivieren, einen aktiven Beitrag zur Gestaltung des eigenen Lebensraums zu leisten.
Unsere Erfahrung mit Dorf- und Gemeindeentwicklungsprozessen zeigt: Menschen engagieren sich grundsätzlich sehr gerne für ihren Wohn- und Lebensort – jedoch weniger auf abstrakter und übergeordneter Ebene, sondern vielmehr ganz konkret. Was interessiert, sind konkrete und umsetzbare Massnahmen und Projekte, die den eigenen Lebensraum verbessern.
Will man die Bevölkerung einer Gemeinde zur Mitwirkung gewinnen, ist es unserer Erfahrung nach von zentraler Bedeutung, die Menschen kennenzulernen und vor allem ihre Bedürfnisse und Sorgen zu erfahren. In drei sehr unterschiedlichen Gemeinden haben wir damit in den letzten drei Jahren wertvolle Erfahrungen sammeln können – bei der Dorfkernentwicklung in Plaffeien FR sowie den Gemeindeentwicklungsprozessen in Fischenthal ZH und Saanen BE.
In allen drei Orten haben wir sehr offen und breit die Bedürfnisse der Bevölkerung abgeholt. Zu diesem Zweck wurden sowohl analoge als auch digitale Tools eingesetzt. Einerseits konnte die Bevölkerung über eigens für den Prozess bereitgestellte Websites ihre Anliegen, Sorgen und Bedürfnisse einbringen – und auch ein Instagram-Account bot dieselbe Möglichkeit. Andererseits nutzten wir bestehende öffentliche Anlässe in den Gemeinden, um die Bedürfniserhebung im direkten Austausch mit den Menschen zu betreiben.
Es stellt sich nun die Frage, was am Ende tatsächlich den grösseren Mehrwert bringt – der digitale oder der analoge Weg? Unsere Erkenntnis ist hierbei klar: eine gute Kombination von beidem, also «DigiLog» macht es aus!
Mithilfe von Onlinetools können viele Menschen auf eine einfache und schnelle Art ihre Anliegen deponieren. Über Instagram können beispielsweise auch Bilder und Eindrücke gesammelt werden: Wo im Dorf halte ich mich gerne auf? Welcher Fleck stört mich am meisten? In erster Linie spricht dieser Kanal eher jüngere Menschen an.
Der digitale Weg hat jedoch auch seine Grenzen. Die Nutzung einer Projektwebsite bedingt, dass sie in der Bevölkerung bekannt ist. Mit der Fülle von Informationen, Websites und anderem ist dies aber schwieriger als man denkt – vor allem zu Beginn eines Entwicklungsprozesses. Die Bekanntheit der Website wächst auch mit der Dauer eines Prozesses. Am Anfang, wenn wir die Bedürfnisse erheben, ist sie noch wenig bekannt. Welche Möglichkeiten man in einer Gemeinde hat, um einen Prozess, ein Projekt oder eben eine Website bekannt zu machen, ist sehr unterschiedlich und hängt stark von den vorhandenen Kommunikationskanälen ab.
Zudem schliesst der digitale Weg auch immer einen Teil der Bevölkerung aus – vor allem ältere Menschen und solche, die wenig affin sind, mit Computer und Smartphone zu agieren. Und am Ende ist die Eingabe eines Textes über eine Website für alle immer auch eine Hürde, die überwunden werden muss: Soll ich mich wirklich schriftlich äussern? Wer liest meine Nachricht? Ist der Datenschutz gewährleistet?
Im direkten Kontakt mit der Bevölkerung stellen sich diese Fragen nicht. Man hört und spürt viel einfacher, wo der Schuh zu drücken scheint. Zudem ist ganz entscheidend, dass Äusserungen durch Nachfragen besser in den aktuellen Kontext gestellt werden können. Das ist für den «bedürfnisorientierten» und «nutzerzentrierten» Ansatz, den wir wählen, zentral – schliesslich wollen wir die Bevölkerung einer Gemeinde verstehen.
Die analoge Bedürfniserhebung ist jedoch sehr ressourcenintensiv und auch begrenzt: an einem Tag mehr als 20 Gespräche zu führen, ist anspruchsvoll und anstrengend. Ausserdem spricht jeder Anlass auch immer nur ein gewisses Publikum an – eine Verzerrung der gesammelten Eindrücke lässt sich somit nicht vermeiden.
Aus unserer Sicht ist auf jeden Fall eine geschickte Kombination von digitalen Tools und analogen Methoden am geeignetsten, um eine möglichst breite und offene Bedürfniserhebung durchzuführen.
Lorenz Kurtz, Mitglied Geschäftsleitung PLANVAL, info@planval.ch
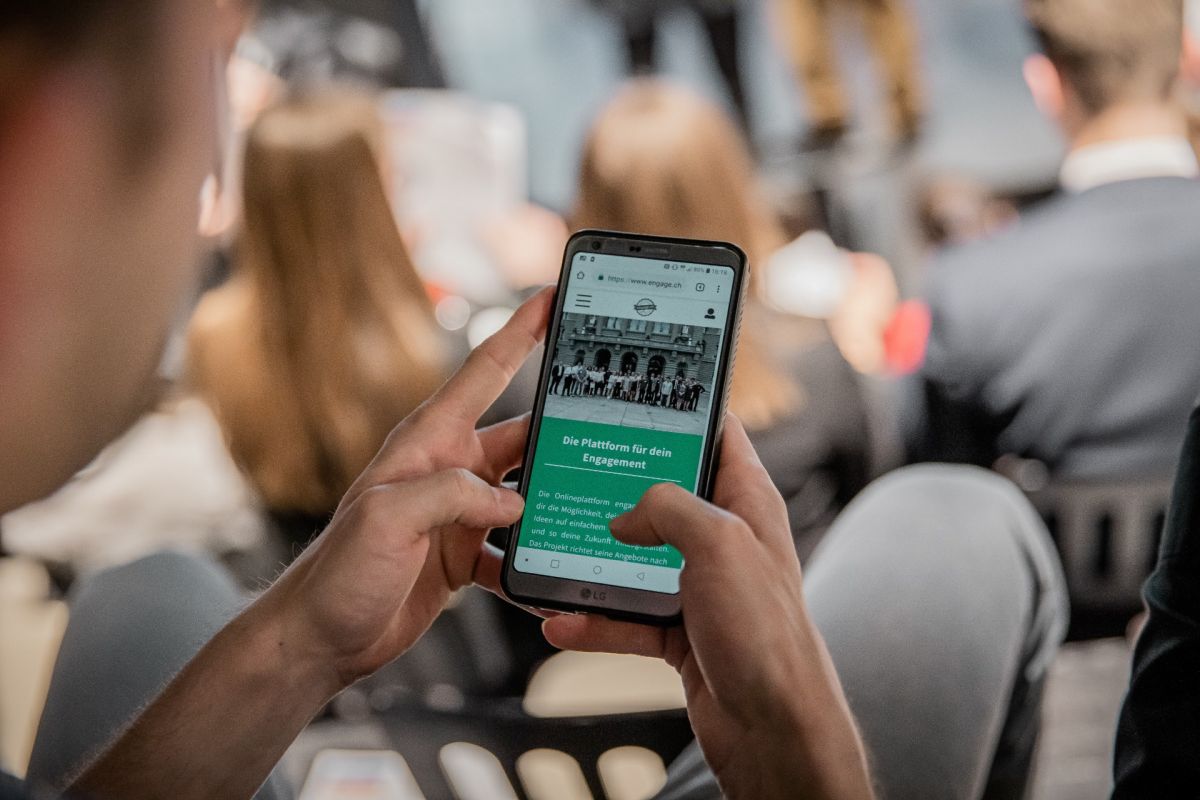
Ein neuer Ast für den Demokratiebaum
Jasmin Odermatt, Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ)
Civic… what? Auch ich habe erst einmal erstaunt geguckt, als ich auf den Einsatz von Civic Technology – kurz Civic Tech – aufmerksam gemacht wurde. In der öffentlichen Debatte ist bisher lediglich die digitale Stimmabgabe, also E-Voting, angekommen. Derzeit sind aber alle E-Voting-Systeme in der Schweiz auf Eis gelegt. Wo am Schweizer Demokratiebaum sind also Civic Tech-Instrumente zu verordnen? Und welche Mittel kommen konkret zum Zug? Eines vorweg: Die Vielfalt an Civic Tech-Tools ist gross und deren Existenz oft weitgehend unbekannt.
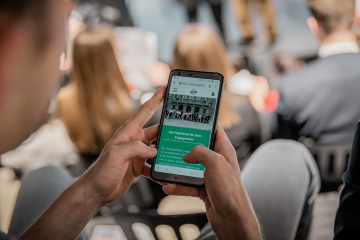
Bei Civic Tech handelt es sich um den Einsatz von digitalen Mitteln, die zur Verbesserung des Einbezugs der Bevölkerung dienen sollen. Konkret können sich so Bürgerinnen und Bürger besser in politische Planungs- und Entscheidungsprozesse einbringen. Das heisst also, dass die Bevölkerung beispielsweise bereits beim Sammeln von Ideen miteinbezogen werden kann und nicht erst bei der Ja-Nein-Entscheidung an der Urne. Civic Tech-Instrumente ermöglichen die direkte Kommunikation mit politischen Amtsträgern, die Mitarbeit an Gesetzesentwürfen und vieles mehr. Das fördert die Mitsprache aller – doch zu den Auswirkungen später mehr.
Weltweit befindet sich die Civic Tech-Szene in einer rasanten Entwicklung. Estland ist das Vorzeigebeispiel einer digitalen Nation schlechthin. In Taiwan reichen Bürgerinnen und Bürger Petitionen online ein, in Island wird auf digitalem Weg über die Verwendung von Bürgerbudgets (sogenannt Participatory Budgeting) bestimmt. Und was ist mit der Schweiz? In der Schweiz hinkt der Civic Tech-Bereich im Vergleich zum Ausland noch hinterher. Es gibt lediglich eine geringe Anzahl wenig bekannter Initiativen, die Civic Tech-Instrumente nutzen. Digitale Tools werden etwa bei Umfragen sowie bei der Raum- und Stadtentwicklung eingesetzt. Auch in politischer Hinsicht werden Potenzial und Risiken des Civic Tech-Bereichs erst schrittweise angegangen, wie anhand von E-Voting erkennbar ist. Derzeit erarbeitet der Bundesrat als Antwort auf ein entsprechendes Postulat von Ständerat Damian Müller einen Bericht zu den Chancen von Civic Tech. In diesem nimmt er die digitale Weiterentwicklung von bestehenden Formen der politischen Partizipation unter die Lupe. Es zeichnet sich also ab, dass Chancen und Risiken von Civic Tech Gegenstand einer grösseren Diskussion sein werden.
Bottom-up-Kommunikation
Weshalb weckt der Einsatz von Civic Tech so grosse Hoffnungen? Die politische Kommunikation hat sich durch die Digitalisierung grundlegend geändert. Heute ist eine stete Interaktion zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen möglich. Politische Kommunikation wird, nicht mehr wie einst nur top-down, sondern vermehrt auch bottom-up initiiert. Das heisst, Bürgerinnen und Bürger können sich proaktiv in die politische Diskussion miteinbringen. Mehr Mitsprachemöglichkeiten für alle führen zu breiter abgestützten Entscheiden. Der Schweizer Demokratiebaum wächst. Während Äste der herkömmlichen Mittel politischer Teilhabe – wie die Unterschriftensammlung für eine Initiative oder Wählen und Abstimmen – weiterhin voll im Saft stehen, wächst mit der digitalen Partizipation auch ein starker neuer Ast heran.
Online nie ohne offline
Aber nun zu den Gründen, die für den Einsatz von mehr Civic Tech sprechen. Der Kontakt und Austausch zwischen Staat und der Bevölkerung erfährt mehr Transparenz, weil er durchwegs öffentlich zugänglich ist. So rücken Bevölkerung und Entscheidungsträgerinnen und -träger näher zusammen und das Vertrauen in die Politik wird erhöht. Weiter können sich durch Civic Tech-Tools auch Menschen beteiligen, die andernfalls von einer Mitsprache ausgeschlossen wären – also zum Beispiel Jugendliche, die unter 18 Jahre alt sind. Das ist gerade hinsichtlich der Tatsache, dass Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren ihre politischen Rechte am seltensten wahrnehmen, relevant. Können sich Jugendliche früh und wirksam am politischen Prozess beteiligen, ist die Chance höher, dass sie dies später weiterhin tun, wie zum Beispiel eine Studie des FORS belegt. Weiter gelangen durch Kommunikationsmittel wie digitale Foren neue, innovative Ideen und Lösungsansätze auf die politische Agenda. Nicht zu vernachlässigen ist gleichzeitig der Offline-Link. Online und offline müssen immer zusammen gedacht werden, damit eine optimale Übertragung digitaler Partizipation ins Analoge funktioniert. Dieser Link ist für das Vertrauen in Civic Tech-Angebote entscheidend. Der persönliche Kontakt bleibt im Zeitalter der digitalen Demokratie also genauso relevant.
Vielfalt an Civic Tech-Instrumenten
Oftmals wird gefragt, ob es denn nun das eine Civic Tech-Tool schon gibt. Derzeit bestimmt jedoch ein Wettbewerb an Instrumenten die Civic Tech-Landschaft der Schweiz. Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ ist zum Beispiel mit engage.ch, einer Partizipationsplattform für Jugendliche, in diesem Bereich vertreten. Weiter sind in der Schweiz zurzeit digitale Dorfplätze, wie sie etwa von Crossiety mit Partnergemeinden erarbeitet werden, auf dem Vormarsch. Das Interesse an Crowdsourcing-Plattformen wie beispielsweise Nextzürich, Inilab und Wecollect wird ebenfalls immer grösser. Auch gibt es vermehrt Städte, die in der Stadt- und Raumentwicklung auf die Verwendung von digitalen Tools setzen. Ein Vorreiter ist diesbezüglich unter anderem «Züri wie neu». Die digitale Partizipation ersetzt folglich nicht die analoge – sie erweitert sie. Der Schweizer Demokratiebaum erhält einen neuen Ast und somit neue Möglichkeiten der Mitsprache.
Jetzt bereits vormerken: Civic Tech-Konferenz des DSJ in Bern, 31. März 2020.
Jasmin Odermatt, Bereichsleiterin Grundlagen Politische Partizipation, DSJ (Dachverband Schweizer Jugendparlamente), info@dsj.ch
Engagiert mit wenigen Klicks – Zivilgesellschaftliche Partizipation durch digitale Lösungen?
Lukas Streit, Five up Community AG
Gesellschaftliche Veränderungen stellen die zivilgesellschaftliche Partizipation vor Herausforderungen. Die Digitalisierung bietet dabei Möglichkeiten, sich diesen Veränderungen anzupassen und Partizipation zu fördern – wenn sie sinnvoll genutzt wird. Ein Erfahrungsbericht.
Die Schweiz ist ein Land der Freiwilligen. In beinahe allen Gesellschaftsbereichen übernehmen Personen auf freiwilliger Basis wichtige Aufgaben – als Unterstützung beim Einkauf der betagten Nachbarin, in Sportvereinen bei der Organisation von Wettkämpfen oder auf kommunaler Ebene in Form eines politischen Amtes.
Viele dieser Bereiche sehen sich heutzutage durch gesellschaftliche Veränderungen mit gros-sen Herausforderungen konfrontiert. Der Alltag ist durch eine zunehmende Schnelllebigkeit und Flexibilität gekennzeichnet – in der Freizeit, in der beruflichen Laufbahn oder in der Gestaltung der individuellen Zukunft. Diese Veränderungen beeinflussen auch die Art und Weise, wie wir uns in unserer Gesellschaft einbringen. Während vor 20 Jahren der Vereinskassier beinahe auf Lebzeiten für sein Amt gewählt war, ist seine Stelle heute immer schwieriger zu besetzen. Für politische Ämter finden viele Gemeinden immer weniger KandidatInnen, die bereit sind, sich für die nächsten Jahre aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen. Soll die zivilgesellschaftliche Partizipation auch in Zukunft aufrechterhalten bleiben, müssen wir die-sen sich verändernden Bedürfnissen mit entsprechenden Partizipationsmöglichkeiten Rechnung tragen.
Neben strukturellen und inhaltlichen Aspekten entscheiden insbesondere die Zugangsmöglichkeiten darüber, ob sich eine Person freiwillig engagiert oder nicht. Will sich heute jemand einbringen, zeigt sich häufig ein unübersichtliches, stark fragmentiertes Angebot an Partizipationsmöglichkeiten. Für Freiwillige stellt sich damit die Frage: Wo wird meine Unterstützung gebraucht? Die Digitalisierung bietet in dieser Hinsicht vielseitige Chancen, um die Partizipation der Bevölkerung nachhaltig zu fördern: durch einen niederschwelligen Zugang, Angebotsbündelung auf einer Plattform, spontanere Einsatzmöglichkeiten und einen verstärkten Aus-tausch zwischen den involvierten Akteuren.
Von den heutigen Bedürfnissen einer engagierten Person ausgehend und mit digitalen Möglichkeiten im Blickfeld haben wir vor einem Jahr das Projekt «Five up» lanciert. Engagierte Personen sollen mit der App «Five up» einfacher Zugang zu Engagements in unterschiedlichen Themenfelder finden, ihre eigenen Aktivitäten besser im Blick behalten und sich spon-taner beteiligen können. Aus einer technischen Sicht zeichnete sich dabei rasch eine klare Struktur ab. Gleichzeitig wurde aber deutlich, dass je nach Einsatzgebiet und den vorhande-nen Prozessen unterschiedliche Anforderungen von Seiten der Nutzer vorliegen. Diese Bedürfnisse und Probleme abzuholen, zu priorisieren und in eine passende technische Lösung umzuwandeln zeigte sich dabei als Schlüssel zum Erfolg des Projektes.
So entwickelte sich «Five up» – im Kern gedacht als einfaches Werkzeug zur Organisation von freiwilligen HelferInnen – rasch selber zu einem partizipativen Projekt, bei dem von Beginn weg interessierte Personen ihre Bedürfnisse einbringen konnten. In agiler Vorgehensweise wurden in mehrwöchigen ‘Sprints’ immer wieder die wichtigsten Bedürfnisse erfasst, technisch umgesetzt und danach direkt von den künftigen Nutzern auf ihre Alltagstauglichkeit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen geprüft.
In der Entwicklung von «Five up» wurde deutlich, dass sich viele Personen bei der Entwicklung zukunftsgerichteter, digitaler Lösungen beteiligen wollen – sofern man ihnen entsprechende Möglichkeiten bietet. Während einige Personen die App direkt physisch vor Ort mit uns ausgetestet haben, nutzten viele die Möglichkeit, sich zuhause durch die Funktionen durchzuklicken und sich auf digitalem Weg einzubringen. Gerade dann, wenn sie dafür Zeit fanden. Auf diese Weise entstand noch vor der offiziellen Lancierung eine Community von über 200 Personen, die sich aktiv am Entstehungsprozess von «Five up» beteiligte. Und mit dieser Community konnte ein digitales Produkt entwickelt werden, bei dem mit wenigen Schritten ein Bedarf und Unterstützung gefunden werden kann.
Bereits früh im Entstehungsprozess stiess «Five up» insbesondere auch im Umfeld von Gemeinden und Städten auf Interesse. Die eigene Bevölkerung zu lokalen Engagements zu motivieren und alle Bevölkerungsgruppen abzuholen, ist heute nicht immer einfach – zu klein oftmals der Bezug der Personen zu lokalen Organisationen oder zu gross die Angst vor einem hohen Zeitaufwand. Mit diesen Problemen konfrontiert, schlossen sich unter anderem die Nachbarschaftshilfe Zürich und das Projekt Nachbarschaft Bern als Netzwerkpartner an, um die Plattform auch für kommunale Organisationen sinnvoll nutzbar zu machen. Insbesondere im Bereich von Nachbarschaftshilfen aber auch im Altersbereich mit Alterszentren zeigten sich mögliche Einsatzgebiete. Die Erfahrungen aus den ersten Einsätzen machten dabei deutlich, dass «Five up» für gewisse einfache Bereiche bereits jetzt einen Mehrwert bieten kann, insbesondere bei kurzfristigen, punktuellen Einsätzen. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass für einen ganzheitlichen Einsatz konstante Weiterentwicklungen notwendig sind. Sobald beispielsweise ein Alterszentrum eine grössere Anzahl Freiwilliger organisieren möchte, ist eine Organisationen über einen Web-Zugang unabdingbar. Gleichzeitig bedarf es auch in der App einer intuitiveren Nutzerführung, um die Freiwilligen noch einfacher zu ihren Eins-ätzen zu bringen. Im Hinblick auf diese Bedürfnisse wird aktuell der Ausbau von «Five up» geplant.
Die Lancierung von «Five up» zeigte jedoch auch, dass nicht alleine nur die technische Umsetzung der Bedürfnisse über den Nutzen einer digitalen Lösung entscheidet. Ein einfacher digitaler Zugang zu unterschiedlichen Partizipationsmöglichkeiten erfordert auch ein Umdenken in der Art und Weise wie diese gefördert werden. So müssen auch Gemeinden erst für sich herausfinden, wie sie digitale Tools in ihren Strukturen gewinnbringend einsetzen können. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die gesellschaftliche Partizipation dann funktioniert, wenn bereichsübergreifend gedacht und vorausgeblickt wird. Die Digitalisierung bietet die Chance, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und Synergien zu nutzen. Im Falle von «Five up» hiess dies, dass nicht isoliert aus der Perspektive einer einzelnen Organisation gedacht, sondern die Herausforderungen und Lösungsansätze unterschiedlicher Akteure einbezogen wurden - von nationalen Organisationen wie dem Schweizerischen Roten Kreuz oder Pro Juventute bis hin zu lokalen Nachbarschaftshilfen, Vereinen und Behörden. Die Digitalisierung kann damit eine Chance bieten, den eigenen Horizont zu erweitern und vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu profitieren.
Die Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern wie auch von den Organisationen zeigen, dass der Ansatz von «Five up» ein guter und sinnvoller Weg sein kann, um die Digitalisierung als Chance zu nutzen. Die Plattform scheint in ihrer Stossrichtung die Bedürfnisse engagierter Personen anzusprechen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass die aktuelle Lösung - «nur die App» - noch nicht genügt. «Five up» wird daher auch jetzt laufend weiterentwickelt und wächst langsam von der isolierten App zu einem digitalen Ökosystem, dass den Bedürfnissen der einzelnen Akteure gerecht werden soll - dank partizipativer Beteiligung mit wenigen Klicks.
Trotz aller Chancen der Digitalisierung muss letztlich aber auch bedacht werden: Die Partizipation basiert immer noch auf der intrinsischen Motivation jedes Einzelnen. Diese Motivation gilt es abzuholen, und dabei kann eine nutzerfreundliche «User-Journey» (Nutzererlebnis) über ein digitales Hilfsmittel unterstützend und fördernd wirken.
Beitrag von Lukas Streit, Projektkoordination Marketing & Kommunikation, Five up Community AG
Fokus Digitale Partizipation
Begriffe wie E-Government, E-Voting und Civic Technology sind in aller Munde. Doch was bedeuten sie für die Partizipation der Schweizer Bürgerinnen und Bürger? in comune greift das Thema Digitalisierung und digitale Partizipation in einer eigenen Rubrik auf und setzt sich insbesondere mit den Fragen auseinander, ob und inwiefern die Digitalisierung die Beteiligung der Bevölkerung am Leben in der Gemeinde fördern kann.
Die Digitalisierung verändert unser Leben. Moderne Technologien ermöglichen es, unterschiedlichste Aktionen einfach, schnell und ortsunabhängig durchzuführen, z.B. den Online-Kauf eines Kleidungsstücks, eines Konzerttickets oder Flugtickets. Das Internet und die elektronischen Geräte haben es uns auch erleichtert, mit Menschen in Kontakt zu treten, die die gleichen Interessen und Leidenschaften teilen: Dank Online-Plattformen können wir heute Informationen und Meinungen in Echtzeit austauschen.
Online-Angebote sind nicht nur für die persönlichen Zwecke der Menschen nützlich. Immer mehr Verwaltungen nutzen das Internet, um der Bevölkerung ihre Dienste vorzustellen und sie über aktuelle Themen und wichtige Ereignisse zu informieren. Der Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Informationen der Verwaltung wird erleichtert, und viele Verfahren können heute über die digitalen Plattformen der verschiedenen Stellen abgewickelt werden. Die Begriffe Cyberverwaltung oder E-Government beziehen sich auf die Nutzung moderner digitaler Verfahren durch Regierungen zur Kommunikation oder Sammlung von Informationen. Online-Dienste erleichtern es den Verwaltungen, Dienstleistungen zu erbringen und Verwaltungsaufgaben zu erfüllen.
in comune greift das Thema Digitalisierung und digitale Partizipation in einer eigenen Rubrik auf. Das Thema ist nicht neu, bleibt aber weiterhin relevant. Im September fand die zweite Ausgabe des Digital Day, einer Initiative von Wirtschaft, Behörden und Wissenschaft, in verschiedenen Schweizer Städten statt. Im März veranstaltete der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) seine erste Konferenz zum Thema Civic Technology, die sich auf die aktive Beteiligung der Bürger am politischen Prozess durch den Einsatz digitaler Plattformen und Instrumente bezog. Bei dieser Gelegenheit wurden die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit der Technologie analysiert und die Notwendigkeit der Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit betont.
Unter den Formen der digitalen politischen Partizipation ist die elektronische Abstimmung zu nennen. Gemäss den Befürwortern vereinfacht E-Voting das Abstimmungsverfahren, verhindert das Hinterlegen von ungültigen Stimmzetteln und macht die Stimmenauszählung effizienter. Die elektronische Stimmabgabe wirft jedoch auch Fragen bezüglich der Sicherheit und des Schutzes personenbezogener Daten einerseits und bezüglich der Gefahr der Stimmrechtsmanipulation andererseits auf. In der Schweiz ist es derzeit nicht möglich, online zu wählen oder abzustimmen. Der Bund prüft die Möglichkeit der Einführung des E-Voting, und in den letzten Jahren haben rund zehn Kantone die ersten Schritte in diese Richtung unternommen, indem sie verschiedene digitale Verfahren getestet haben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der digitalen Partizipation ist die Zugänglichkeit. Nicht alle Bürger haben Zugang zum Internet bzw. zu den elektronischen Devices. Daher müssen die Auswirkungen der sogenannten digitalen Spaltung (digital divide) berücksichtigt werden.
In den nächsten Wochen werden wir das Thema der digitalen Partizipation vertiefen und uns insbesondere damit befassen, ob und wie die Digitalisierung helfen kann, die Beteiligung der Bürgerinnen und der Bürger am Leben ihrer Gemeinde zu fördern. Wir werden Projekte vorstellen, die der Bevölkerung neue Möglichkeiten der Partizipation anbieten sowie Beiträge von Experten veröffentlichen, um zu verstehen, wie die Möglichkeiten der neuen digitalen Technologien am besten genutzt werden können.
Wir danken allen, die zu dieser Serie beigetragen haben, und wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre!
- E-Government (elektronischer Stimmkanal) bedeutet den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in öffentlichen Verwaltungen in Verbindung mit organisatorischen Änderungen und neuen Fähigkeiten, um öffentliche Dienste und demokratische Prozesse zu verbessern und die Gestaltung und Durchführung staatlicher Politik zu erleichtern. (Quelle)
- Civic Technology oder Civic Tech bezeichnet im Allgemeinen man damit eine große Anzahl von technischen Konzepten, deren Ziel es ist, die Beteiligung an politischen Prozessen zu vereinfachen. Das politische Engagement der Bürger soll unter anderem durch die Einführung von Kommunikationsplattformen und anderen technischen Infrastrukturen gefördert werden. (Quelle)
- E-Voting bedeutet, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger übers Internet abstimmen und wählen können. Es ermöglicht damit eine orts- und zeitunabhängige Stimmabgabe. Gebräuchlich ist auch der Begriff elektronischer Stimmkanal. (Quelle)
- Digital divide (digitale Spaltung) ist die Kluft zwischen denjenigen, die dank den neuen, digital verfügbaren Angeboten ihr Wissen vergrössern können, und denjenigen, die an diesem Fortschritt nicht teilhaben können. (Quelle)

Wenn ein Quartier Heimat gibt, gibt es auch sozialen Halt
Eveline Rutz, Journalistin
Wie gelangt man in einem sozial belasteten Stadtteil zu einem lebendigen Miteinander? Winterthur (ZH) verfolgt einen vernetzten und interdisziplinären Ansatz. Dank diesem begegnet man sich in Töss zunehmend auf Augenhöhe.
Töss ist ein vielschichtiges Quartier. Der Verkehr und ein in die Jahre gekommener Betonbau dominieren das Zentrum. Der Geräuschpegel ist hoch, Staub liegt in der Luft. Wenige Schritte davon entfernt sorgen alte Häuser und verschlungene Strassen für einen dörflichen Charakter. Hier ist es ruhig und grün. An der Töss schlendern Spaziergänger mit Hunden vorbei, Kinder spielen.
So vielfältig wie die Fassaden sind, so vielfältig ist die Bevölkerung zusammengesetzt. Der Ausländeranteil liegt bei 34 Prozent. Im städtischen Monitoring schneidet Töss jeweils als sozial besonders belastet ab. Hier leben überdurchschnittlich viele Menschen, die ein tiefes Einkommen haben, arbeitslos sind oder Sozialhilfe beziehen. National in die Schlagzeilen gelangte der Stadtteil 2014, als sich ein minderjähriges Geschwisterpaar dem IS anschloss. Die etwas abseits gelegene Siedlung Steig kam in Verruf, eine Dschihadisten-Hochburg zu sein.
«Töss ist kreativ, pulsierend, originell und manchmal unberechenbar», sagte Stadtpräsident Michael Künzle kürzlich auf Einladung des Netzwerks Lebendige Quartiere. Dieses hatte unter dem Titel «Prävention und Integration: Miteinander zu einem lebenswerten Quartier» zu einem Rundgang eingeladen. Städtebaulich, aber auch sozial gelte es hier Brücken zu schlagen, fuhr der CVP-Politiker fort. «Winterthur hat eine lange Tradition im vernetzten und interdisziplinären Bearbeiten komplexer Fragestellungen.» Auf die dschihadistischen Radikalisierungen reagierte die Stadtregierung unter anderem, indem sie 2016 die Fachstelle «Extremismus und Gewaltprävention» schuf.
Lokale Strukturen stärken
Deren Leiter, Urs Allemann, hob die Bedeutung der lokalen Ebene hervor. Hier könne Prävention viel bewirken. «Wenn ein Quartier Heimat gibt, ist dies ein Schutz gegenüber Extremismus.» Entsprechend wichtig sei es, lokale Strukturen zu stärken. Vereine etwa hätten eine Integrationsfunktion – gerade für Personen, die sich in problematischen Kreisen bewegten. «Die Folgen von Radikalisierungen fallen auf die lokale Ebene zurück», gab der Sozialarbeiter zu bedenken. Er trifft sich regelmässig mit Mitarbeitenden der Integrationsförderung und dem Brückenbauer der Stadtpolizei. Ziel ist es, gemeinsame Haltungen zu entwickeln. Jan Kurt hatte in Töss bereits acht Jahre lang als Quartierpolizist im Einsatz gestanden, als er Anfang 2017 die neu geschaffene Stelle als Brückenbauer antrat. Er weiss, wo sich Jugendliche abends treffen, wo Nachbarn immer wieder in Streit geraten und das Rotlichtmilieu verkehrt. «Es gibt keinen Unterschied zu anderen Quartieren», sagte er auf die Kriminalitätsstatistik angesprochen.
Grenzen gemeinsam aushandeln
Es gehe darum, im Zusammenleben Vielfalt zuzulassen und zu nutzen, sagte Thomas Heyn, Leiter Fachstelle Integrationsförderung. Migranten seien einzubeziehen und Grenzen gemeinsam auszuhandeln. Gleichzeitig müssten bestehende Vorschriften befolgt werden.Heyn erinnerte daran, dass Winterthur im 20. Jahrhundert eine Industriestadt gewesen war und auch Arbeitskräfte aus dem Ausland angezogen hatte. Um ihnen den Alltag in der neuen Heimat zu erleichtern, wurde 1974 die städtische Ausländerberatungsstelle geschaffen, früher als anderswo.
Töss hat finanzielle Priorität
Im multikulturellen Töss, das aktuell rund 11 000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, setzt die Stadt ihre finanziellen Mittel für Integration und Prävention prioritär ein. Von 2006 bis 2010 realisierte sie das «Projekt Töss», aus dem mit dem Gemeinschaftszentrum im Bahnhofsgebäude und dem Güterschuppen zwei Treffpunkte entstanden. Eine Mitarbeiterin der Fachstelle Quartierentwicklung ist einmal wöchentlich vor Ort anzutreffen. Eine Dienstleistung, die nur in diesem Stadtteil angeboten wird. «Die Bevölkerung kann mit Ideen direkt zu mir kommen», sagte Simone Mersch auf dem Rundgang. Klassisches Beamtenmobiliar findet man in ihrem «Aussenbüro» keines. Bequeme Sofas und eine Kaffeemaschine sorgen stattdessen dafür, dass man sich in einer angenehmen Atmosphäre austauschen kann. «Man lebt gerne in Töss», betonte Simone Mersch. Der Stadtteil werde gerade ein wenig hip. Da und dort werde saniert und aufgewertet. Gerade junge Familien schätzten die Ruhe, die abseits der Verkehrsachsen herrsche, und die günstigen Mieten. Die Durchmischung sei gut.
«Die Lebensqualität ist hoch», bestätigt Monika Imhof, langjährige Präsidentin der Tösslobby, dem Dachverband der lokalen Vereine, der ebenfalls auf das «Projekt Töss» zurückgeht. Im ersten Anlauf sei es nicht gelungen, Migrantinnen und Migranten einzubeziehen. Sie hätten zwar einzelne Veranstaltungen besucht, wirkten in den lokalen Strukturen jedoch immer noch nicht mit.
Gelebte Partizipation: acht Nationen im Vorstand von «Paradise Töss»
Mit «Paradise Töss» ist man nun auf gutem Weg, daran etwas zu ändern. Das Projekt, das von der Stadt, dem Kanton und dem Förderprogramm Citoyenneté unterstützt wird, setzt auf Partizipation. Im Vorstand arbeiten 14 Personen aus acht Nationen mit. «Das ist anspruchsvoll, aber der einzige Weg zum Erfolg», sagt Projektleiterin Imhof. Sie erzählt, wie aufwendig es nur schon war, die Einladung zur öffentlichen Auftaktveranstaltung zu gestalten. Deren Titel, «Zusammenleben in Töss», sollte auf dem Flyer in allen Sprachen zu lesen sein, die im Quartier gesprochen werden. Bis sämtliche Übersetzungen korrekt waren, dauerte es. Am Anlass sind dann Ideen gesammelt worden, wie das Miteinander gefördert werden könnte. Wer bereit war, sich zu engagieren, konnte sich einer Arbeitsgruppe anschliessen. Imhof sagt: «Dann passierte lange erst einmal nichts.» Irgendwann habe das Netzwerk aber doch zu tragen begonnen. Einige der Vorschläge wurden umgesetzt, so eine Tauschbörse und eine Hausaufgabenhilfe. Besonders Anklang fand ein Rundgang durch die drei Gotteshäuser. Rund 80 Tössemer besuchten gemeinsam die Moschee, die katholische sowie die reformierte Kirche. Sie erfuhren aus erster Hand, wie der jeweilige Glaube zelebriert wird, und tauschten sich aus. «Es war magisch», erinnert sich Monika Imhof.
Sie fasst ihre Erkenntnisse aus dem Projekt gerade in einem Leitfaden zusammen. Der konsequent partizipative Ansatz habe sich gelohnt, sagt sie. Entscheidend sei die Haltung: «Wir haben die ausländische Bevölkerung vom ersten Moment an auf Augenhöhe eingebunden.» So habe sie gemerkt, dass sie ernst genommen werde und etwas bewirken könne. Als grosse Hürde erwies sich die Sprache. Doch auch diesbezüglich fand man einen Weg: In einem WhatsApp-Chat war die Hemmschwelle, Fehler zu machen, geringer als per Mail. «Paradise Töss» habe Modellcharakter, lobt Stadtpräsident Künzle. Die Stadt sei auf Freiwillige angewiesen, die sich in den Quartieren engagierten. Sie gelange durch sie an wichtige Informationen. «Es ist entscheidend, die Menschen in ihren jeweiligen Lebensräumen zu kennen.»
Dieser Artikel wurde von Eveline Rutz geschrieben und ist in der November-Ausgabe der Zeitschrift «Schweizer Gemeinde» erschienen.
Mehrere Informationen unter: www.lebendige-quartiere.ch
So gelingt der Aufbau von Coworking auch auf dem Land
Andreas Choffat, Village Office
Welches sind die Erfolgsfaktoren von Coworking Spaces ausserhalb von grossen Städten? Eine Masterarbeit an der HSLU Wirtschaft hat sieben Erfolgsfaktoren für periurbane Coworking Spaces identifiziert.
Mit der Digitalisierung haben sich neue Formen von Arbeit entwickelt. Dazu gehören auch Coworking Spaces. Sie bieten Flexibilität, fördern den Austausch, stärken die Gemeinschaft und entlasten die Verkehrsinfrastruktur. Und sie kurbeln die lokale Wirtschaft an – insbesondere in ländlichen Gebieten.
Die Rahmenbedingungen
Die Genossenschaft VillageOffice ist vom Potenzial von Coworking ausserhalb von grossen Städten überzeugt. Ihr Ziel: Bis zum Jahr 2030 erreicht jede Person in der Schweiz den nächsten Coworking Space innerhalb von 15 Minuten per Velo oder ÖV. Damit will die Genossenschaft die Verkehrsinfrastruktur entlasten, die lokale Wertschöpfung in den Gemeinden steigern und mit kürzeren Arbeitswegen die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern. Dieses Ziel will VillageOffice erreichen, indem sie neue Arbeitsformen fördert und ein schweizweites Netzwerk von VillageOffice-Partner-Spaces aufbaut. Das sind Coworking Spaces, eingebettet in ein Netzwerk von lokalen Dienstleistern in den Gemeinden. Dazu begleitet und berät VillageOffice Gemeinden rund um Coworking – von der Potenzialabklärung und dem Aufbau einer Gemeinschaft (Community) über das Testen, Konzipieren und Aufbauen eines Coworking Space bis hin zum Betrieb.
Erfolgreiche Coworking Spaces erkennt man an der Nutzung
Ein Coworking Space ist ein Ort, an dem gearbeitet wird. Das heisst, an dem die Arbeitsinfrastruktur vorhanden ist. Ein Coworking Space ist aber auch ein Ort, an dem soziale Interaktion stattfindet und ein kreativer Nährboden entsteht. Ein bunt durchmischtes Zuhören, Erzählen, Austauschen, Bereichern. Es gibt unterschiedliche Konzepte und Ziele für Coworking Spaces. Erfolgreiche Coworking Spaces haben aber alle einen gemeinsamen Nenner: die Nutzung. Je besser ein Coworking Space vernetzt und damit ausgelastet ist, desto erfolgreicher ist dieser.
Mit sieben Faktoren zum Erfolg
Christian Amstad nennt in seiner Masterarbeit an der Hochschule Luzern Wirtschaft sieben Erfolgsfaktoren für Coworking Spaces in ländlichen Räumen, die sich auch in der Praxis bewährt haben. Die ersten fünf Faktoren kann eine Gemeinde beeinflussen. Bei den Faktoren 6 und 7 besteht wenig Handlungsspielraum für die lokalen Institutionen. Beim Faktor 7 engagiert sich VillageOffice zusammen mit der Work-Smart-Initiative und weiteren Partnern, die diese Rahmenbedingungen verändern möchten.
- Gemeinden, Immobilienbesitzer, Sponsoren und Coworking-Betreiber können helfen, in der Startphase die Betriebskosten zu senken. Zum Beispiel: reduzierte Mietpreise, finanzielle oder materielle Unterstützung, unentgeltliche Arbeit.
- Die Netzwerkgrösse beeinflusst das Potenzial der Auslastung und legt den Grundstein für eine aktive Community. Die persönliche Vernetzung spielt bei ländlichen Gemeinden eine entscheidende Rolle – insbesondere mit den Nachbarn.
- Eine Arbeitsgemeinschaft mit gemeinsam gelebten Werten sichert eine minimale Auslastung des Space. Je ländlicher und kleiner ein Coworking Space, desto weniger Leute braucht es für eine funktionierende Gründergruppe.
- Motivierte Menschen und Organisationsform: Coworking-Betreiber stehen für ihre Region ein und sind intrinsisch motiviert. Sie wählen eine Organisationsform, die das Anpassen von Rahmenbedingungen und das Mitwirken der Community erlaubt.
- Attraktives Angebot: Ohne gutes Angebot überlebt kein Coworking Space. Darin enthalten sind: Atmosphäre, Lage, Zugang, Preis–Leistung, Infrastruktur.
- Liberales Umfeld: Je grösser die liberale Grundhaltung einer Bevölkerung, desto eher ist diese offen für Neues und an neuen Formen von Arbeit interessiert.
- Rahmenbedingungen: Fortbestehen und Wachstum der Coworking-Branche braucht Unterstützung von Politik (Förderung von dezentralem Arbeiten) und Wirtschaft (Employee Branding der Unternehmen).
Andreas Choffat, im Auftrag der Genossenschaft VillageOffice.
Coworking mit Erfolg: Die Gemeindeplattform hilft dabei
Um die Schweizer Gemeinden zu unterstützen, hat die Genossenschaft VillageOffice in Zusammenarbeit mit der Klimastiftung Schweiz und EnergieSchweiz die Gemeindeplattform entwickelt. Die digitale Plattform berechnet, vernetzt und verschafft Überblick über das Potenzial von Coworking in den Schweizer Gemeinden. Auf der Plattform steht jeder Schweizer Gemeinde eine eigene Landingpage mit Pendlerdaten der Gemeinde, einer Petitionsfunktion und einem Diskussionsbereich zur Verfügung. Die Landingpage einer Gemeinde wird direkt im Browser aufgerufen:
villageoffice.ch/ihregemeinde
VillageOffice empfiehlt folgendes Vorgehen für Schweizer Gemeinden im Umgang mit Coworking:
- Link zur Landingpage der Gemeinde dem Bekanntenkreis versenden und ihn auf anderen offiziellen Kanälen teilen. So finden Gemeindepolitikerinnen und -politiker heraus, wie viele Bürgerinnen und Bürger die Petition ausfüllen oder einen Wunsch auf der Landingpage hinterlegen. Das ist ein erstes Indiz für das künftige Mitmachen der Bevölkerung.
- Parallel dazu in den lokalen Medien, an Stammtischen und Treffen über die Vorteile von flexiblem Arbeiten in der Gemeinde sprechen. VillageOffice kann diesen Prozess mit einem Mandat kommunikativ begleiten. Die Initiative und die Organisation bleiben in der Gemeinde.
- Auf dieser Basis erkennen Gemeinden rasch, ob eine erste, wichtige Bewegung in der Gemeinde entsteht.
- Ist dies der Fall, unterstützt VillageOffice gern bei der Durchführung einer öffentlichen, partizipativen Informationsveranstaltung mit der bereits vorhandenen Spurgruppe und der Bevölkerung.
So kann VillageOffice Gemeinden unterstützen
VillageOffice zeigt in einem persönlichen Gespräch mit Vertretern der Gemeinde, wie der Prozess von einer ersten Informationsveranstaltung in der Gemeinde bis hin zum Betrieb eines Coworking verläuft und wie eine Zusammenarbeit mit VillageOffice aussehen kann. Die Genossenschaft arbeitet dazu mit ihrem Phasenmodell. Am Gespräch zeigt VillageOffice pro Phase, welche Aufwände lokal und welche bei VillageOffice anfallen und wie der Prozess im Normalfall finanziert wird.
Ein Coworking Space ist ein Ort, an dem gearbeitet wird. Das heisst, dass die Arbeitsinfrastruktur vorhanden sein muss. VillageOffice fördert diese neue Arbeitsform in Gemeinden, die etwas abseits von den Zentren liegen.

Bild: VillageOffice Partner Space BlueLab, Yverdon
Wer dem Staat unterworfen ist, muss wählen dürfen
Anna Goppel, Universität Bern
Das Wahl- und Stimmrecht auf Bundesebene ist in der Schweiz Bestandteil der Staatsbürgerschaft. Für all jene, die nicht von Geburt an darüber verfügen, ist der Zugang zur Staatsbürgerschaft an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Das Wahl- und Stimmrecht von diesen Bedingungen abhängig zu machen, widerspricht der Gleichbehandlung und ist demokratisch defizitär, wie Anna Goppel ausführt.
Im Jahr 2016 waren nach provisorischen Angaben des Bundesamts für Statistik mehr als 19,8 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz über 18 Jahre alt und ohne Schweizer Pass. Wenngleich sie im wahlrechtsrelevanten Alter waren, durften diese Menschen in der Schweiz nicht wählen. Das Wahl- und Stimmrecht auf Bundesebene ist in der Schweiz Bestandteil der Staatsbürgerschaft, und die Staatsbürgerschaft erwerben können jene, die nicht per Geburt darüber verfügen, nur, wenn sie eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Nach Kanton teilweise variierend, erhalten sie das Wahlrecht deshalb im Regelfall erst, wenn sie bereits 12 Jahre in der Schweiz gelebt haben, integriert sind, Kenntnisse über den Staatsaufbau, die Geschichte, Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuche der Schweiz und des Kantons nachweisen können, nicht von der Sozialhilfe leben, keine Einträge im Strafregister haben und Kenntnisse einer der Landessprachen belegen. Lässt sich dies rechtfertigen?
Der staatlichen Autorität unterworfenViele sind der Ansicht, dass diejenigen, die das Wahlrecht bereits haben, nach eigenem Ermessen bestimmen können sollen, wem das Wahlrecht unter welchen Bedingungen zukommt. Da das Schweizer Wahlvolk, bzw. dessen Repräsentant*innen die Wahlrechtsregeln beschlossen haben, wären diese und der auf sie zurückzuführende Ausschluss vieler Migrant*innen vom Wahlrecht damit nicht zu kritisieren. Übersehen wird dabei, dass es einen moralischen Anspruch auf politische Mitbestimmung gibt.
Wenn wir denjenigen, die einen solchen Anspruch haben, das Wahlrecht verweigern, handeln wir sowohl ethisch als auch demokratisch problematisch. So war es beispielsweise ethisch falsch, als eine rein männliche Wählerschaft entschieden hat, Frauen das Wahlrecht zu verweigern, weil Frauen eben einen Anspruch auf Mitbestimmung haben. Und die Entscheidung war demokratisch defizitär, weil demokratische Legitimität nicht nur von der Einhaltung demokratischer Prozeduren abhängt, sondern auch davon, dass das Wahlvolk richtig zusammengesetzt ist, d.h. alle umfasst, die einen Anspruch auf Mitbestimmung haben. Ebenso verhält es sich heute mit der Verweigerung des Wahlrechts für viele Migrant*innen.
Ein Anspruch auf Mitbestimmung kommt meiner Ansicht nach all jenen zu, die der Autorität des entsprechenden Staates und damit dessen Gesetzen und Entscheidungen in relevanter Weise unterworfen sind. Weshalb? Weil die Unterwerfung unter zwangsbewehrte Gesetze ethisch nur dann vertretbar ist, wenn die Gruppe derjenigen, deren Leben davon geregelt wird, diese Gesetze selbst bestimmt. So wie es inakzeptabel ist, dass mein Ehepartner ohne meine Einwilligung die Regeln bestimmt, denen ich im Haushalt zu folgen habe, ist es inakzeptabel, dass eine bestimmte Gruppe über staatliche Vorschriften entscheidet, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das anderer regeln.
Um anhand dieser Auffassung entscheiden zu können, wem das Wahlrecht in einem Staat zusteht, müssten wir klären, wie umfassend und wie lange wir dafür der Autorität eines Staates unterworfen sein müssen. Ohne Zweifel sind all diejenigen hinreichend der Autorität eines Staates unterworfen, die ihren Lebensmittelpunkt für eine gewisse Zeitdauer vollständig dorthin verlegt haben. Die Gesetze und Entscheidungen dieses Staates regeln ihr Leben. Sie sind dort krankenversichert und bringen dort ihre Kinder zur Schule, dort ist geregelt, wie sie im Alter versorgt sind, wen sie heiraten dürfen, ob sie Kinder adoptieren können, wem sie Geld vererben können, ob sie berechtigt sind, eine Ausbildung zu machen und vieles mehr.
Weitere Zugangsbedingungen?Diese Menschen haben einen Anspruch auf Wahlrecht, weil sie staatlicher Autorität unterworfen sind und nicht weil sie gut integriert oder ökonomisch von staatlicher Hilfe unabhängig sind. Die einzige Bedingung, die darüber hinaus vertretbar ist, ist die minimale Bedingung, dass eine Person in der Lage sein muss, eine Wahlentscheidung zu treffen. Deshalb haben richtigerweise auch Kinder noch nicht das Recht, ihre Stimme abzugeben, obwohl auch sie der staatlichen Autorität unterworfen sind. Die Bedingungen, an die das Wahlrecht von Migrant*innen in der Schweiz derzeit darüber hinaus geknüpft ist, lassen sich demgegenüber nicht rechtfertigen:
Abgesehen davon, dass man mit Blick auf einen Teil dieser Bedingungen wie etwa der Unabhängigkeit von Sozialhilfe oder auch der unbescholtenen strafrechtlichen Vergangenheit keinen Zusammenhang zum Wahlrecht herstellen kann, scheitern diese Bedingungen bereits am Prinzip der Gleichbehandlung. Denn Staatsbürger*innen erhalten das Wahlrecht unabhängig von der Erfüllung dieser Bedingungen, und es lässt sich kein Unterschied zwischen Staatsbürger*innen und Migrant*innen ausmachen, der diese Ungleichbehandlung rechtfertigen könnte.
Sprachkenntnis als Unterscheidungsgrund?Man mag bezweifeln, dass sich mit dieser Begründung auch Bedingungen wie Sprachkenntnisse oder Aufenthaltsdauer zurückweisen lassen. Ohne Sprachkenntnisse und das Wissen, das man durch Aufenthalt erwirbt, so die Überlegungen, die diesen Bedenken häufig zugrunde liegen, scheitere man bereits am Ausfüllen des Wahlzettels, spätestens aber daran, eine wohl informierte Wahl zu treffen.
Meines Erachtens sind wir auch ohne Sprachkenntnisse und vorgängigen Aufenthalt durchaus fähig, überhaupt oder vernünftig zu wählen. Aber selbst wenn wir fehlenden Sprachkenntnissen den befürchteten Effekt zuschreiben würden, dürfte das Wahlrecht davon nicht abhängen. Denn die Unfähigkeit zu wählen wäre in diesem Fall keine prinzipielle Unfähigkeit, sondern den Umständen geschuldet. Und wenn wir das Wahlrecht von solchen nicht prinzipiellen Unfähigkeiten abhängig machen wollten, müssten wir auch Menschen, die etwa aufgrund mangelnder Sehfähigkeit den nicht blindengerechten Wahlzettel nicht ausfüllen können, das Wahlrecht verweigern. Zu Recht sind wir jedoch der Meinung, dass wir diesen Menschen die Wahl ermöglichen müssen. Ebenso dürften wir diejenigen, denen Sprachkenntnisse fehlen, nicht vom Wahlrecht ausschließen, sondern müssten Sorge tragen, dass sie die notwendigen Informationen erhalten.
Das Wahlrecht darf lediglich von der prinzipiellen und basalen Fähigkeit, eine Wahlentscheidung zu treffen, sowie der Autoritätsunterworfenheit abhängig gemacht werden. Man muss es sich nicht verdienen, sondern hat einen Anspruch darauf, wenn man Teil der Gruppe ist, die den zwangsbewehrten Gesetzen eines Landes unterworfen ist.
Dieser Text ist erschienen in Antidot-Inclu, Nr. 26, Januar 018, S. 28.
Autorin: Anna Goppel ist Professorin für praktische Philosophie mit Schwerpunkt politische Philosophie an der Universität Bern. In ihrer Forschung befasst sich Anna Goppel gegenwärtig mit ethischen Fragen der Migration, der politischen Mitbestimmung und Staatsbürgerschaft, mit moralischer Komplizenschaft sowie mit der normativen Bedeutung von Nahbeziehungen.
Zahlen und Fakten zum Wahlrecht für Ausländer
Andreas Müller & Tobias Schlegel
In einer im Herbst 2015 erschienenen Studie hat sich Avenir Suisse mit dem passiven Wahlrecht für Ausländer auf Gemeindeebene befasst, also dem Recht, ohne Schweizer Nationalität in ein kommunales Amt gewählt werden zu können. Ziel der Studie war es, Daten zur Existenz und zur Nutzung des passiven Wahlrechts in der Schweiz zu sammeln und damit eine bestehende Wissenslücke zu schliessen.
Passives Wahlrecht in einem Viertel aller Gemeinden
Aktuell ist das passive Wahlrecht für Ausländer in den sieben Kantonen Jura, Appenzell-Ausserrhoden, Waadt, Graubünden, Freiburg, Basel-Stadt und Neuenburg in Kraft. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied zwischen der Deutschschweiz und der Romandie: Während das passive Wahlrecht in den Westschweizer Kantonen für alle Gemeinden gilt, überlassen es die drei Deutschschweizer Kantone ihren Gemeinden, ob sie den ausländischen Einwohnern das passive Wahlrecht gewähren wollen («Opting-in»). In Graubünden machen 22 der 125 Gemeinden davon Gebrauch, im Kanton Appenzell-Ausserrhoden sind es 3 von 20, in Basel-Stadt keine einzige. Schweizweit gewähren 600 Gemeinden mit gesamthaft mehr als einer Million Einwohner das passive Wahlrecht. Das entspricht rund einem Viertel aller Gemeinden. Grosse Unterschiede gibt es dabei auch hinsichtlich der Anforderungen an die Wohnsitzdauer, die für die Erteilung des passiven Wahlrechts erfüllt werden müssen. Freiburg, Neuenburg und die Mehrheit der Gemeinden in Graubünden erteilen das passive Wahlrecht frühestens nach fünf Jahren, während man in den Kantonen Waadt, Jura und Appenzell-Ausserrhoden sowie in einzelnen Gemeinden des Kantons Graubünden für mindestens zehn Jahre in der Schweiz wohnhaft sein muss.
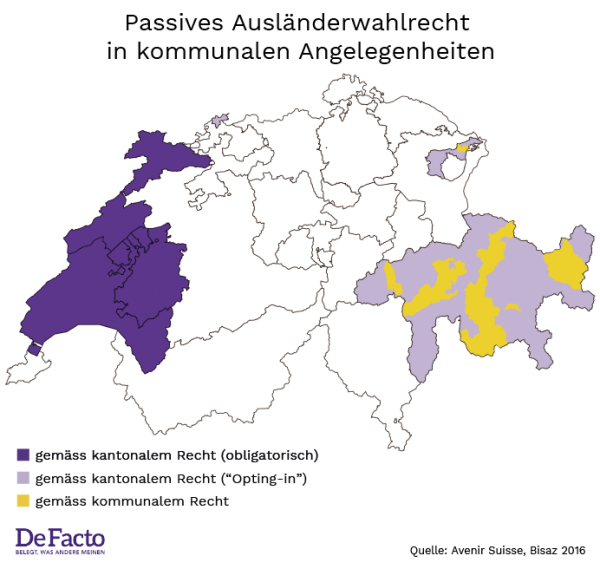
Wo werden Ausländer gewählt?
Erstaunlicherweise ging noch keine Studie dieser Frage gesamtschweizerisch auf den Grund. Deshalb hat sich Avenir Suisse entschieden, mittels eines Online-Fragebogens bei den Gemeinden, die das passive Ausländerwahlrecht haben, nachzuhaken (vgl. Infobox «Online-Umfrage, Methode und Einschränkungen). Für die 317 Gemeinden, die an der Umfrage teilgenommen haben, ergaben sich folgende Resultate:
- In 37 Gemeinden wurde bereits ein Ausländer in die Exekutive gewählt. Die Mehrheit dieser Gemeinden befindet sich in den Kantonen Waadt (20) und Freiburg (12), einige im Jura (3), und nur jeweils eine in den Kantonen Neuenburg und Appenzell-Ausserrhoden.
- Insgesamt wurden bisher 39 Ausländer in die Exekutive gewählt. Davon sind 19 aktuell noch im Amt. Diese sind in den Kantonen Waadt (11), Freiburg (5), Jura (2) und Neuenburg (1) politisch aktiv.
- In 177 Gemeinden nahmen bereits Ausländer an der Gemeindeversammlung teil oder wurden in die Legislative gewählt. Besagte Gemeinden liegen in den Kantonen Waadt (110), Freiburg (41), Neuenburg (11), Jura (9) und Graubünden (6).
- Derzeit engagieren sich 148 Ausländer aktiv in Gemeindelegislativen (inkl. Gemeindeversammlungen), davon die grosse Mehrheit im Kanton Waadt (115), aber auch in Neuenburg (15), Freiburg (11) und Jura (5). Im Kanton Appenzell-Ausserrhoden sind zwei Ausländer in der Legislative aktiv.
- Gesamtschweizerisch waren in der Vergangenheit 132 Ausländer in Gemeindelegislativen aktiv.
Das kriselnde Milizsystem beleben
Die relativ tiefen Fallzahlen belegen, dass sowohl aktuell als auch in der Vergangenheit wenig Ausländer in politische Ämter gewählt wurden, besonders in der Exekutive. Dies ist u.a. Ausdruck davon, dass die politischen Rechte für Ausländer Vielen unbekannt sind. Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen der Deutschschweiz, wo aktuell zwei Ausländer politisch aktiv sind, und der Romandie, die in Legislative und Exekutive 165 aktive Ausländer zählt. Auffallend ist auch, dass 13 der insgesamt 19 ausländischen Exekutivpolitiker in kleinen Gemeinden mit weniger als tausend Einwohnern tätig sind (vgl. Abbildung 2).
Diese Beobachtung ist besonders mit Blick auf das Milizsystem interessant, bekunden doch zumeist kleinere Gemeinden Mühe, passende Kandidaten zu finden. Vor diesem Hintergrund empfiehlt Avenir Suisse: Kantone, die aktuell kein passives Wahlrecht für Ausländer kennen, sollen es ihren Gemeinden erlauben, den ausländischen Einwohnern das passive Wahlrecht (inkl. die anderen politischen Rechte auf kommunaler Ebene) zu erteilen («Opting-in»). Die Kriterien dafür müssten deutlich lockerer sein als bei der Einbürgerung. So könnte das Milizsystem wieder belebt werden, mit dem schönen Nebeneffekt eines positiven Einflusses auf die Integration ausländischer Mitbewohner.
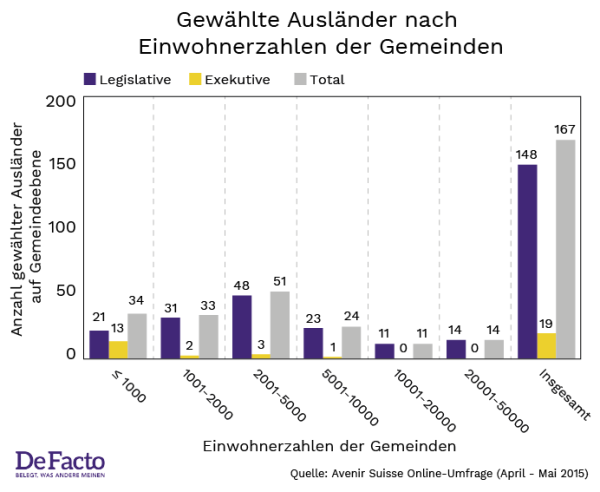
Beitrag von Andreas Müller & Tobias Schlegel erschienen auf deFacto.
Infobox: Unterschiedliche politische Rechte
Unter dem Begriff der politischen Rechte sind mehrere Formen der Beteiligung zusammengefasst:
- Mitbestimmungsrecht: Das Recht der Teilnahme an Unterschriftensammlungen für Petitionen, Referenden oder Initiativen;
- Stimmrecht: Das Recht, sich zu einem Thema zu äussern, das zur Abstimmung gebracht wurde, etwa im Rahmen eines Referendums oder einer Volksinitiative;
- Aktives Wahlrecht: Das Recht, Kandidaten zu wählen, die für ein politisches Amt zur Verfügung stehen;
- Passives Wahlrecht: Das Recht, selbst für ein politisches Amt zu kandidieren und gewählt zu werden.
Das passive Wahlrecht kann gewissermassen als höchstes der politischen Rechte bezeichnet werden. Oft werden Stimm- und aktives Wahlrecht erteilt, nicht aber das passive Wahlrecht. So beispielsweise auf Kantonsebene in Neuenburg und Jura oder auf Gemeindeebene im Kanton Genf.
Beitrag teilen
Fokus Ausländerpartizipation
In der Schweiz können alle volljährigen Frauen und Männer mit Schweizer Bürgerrecht an eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen und Wahlen teilnehmen sowie auch ein Referendum bzw. eine Volksinitiative lancieren oder beides unterzeichnen. Volljährige Auslandschweizer und -schweizerinnen können auf eidgenössischer Ebene abstimmen und wählen, aber nur manche Kantone und Gemeinden gewähren ihnen diese Rechte auf kantonaler und kommunaler Ebene.
Das Stimm- und Wahlrecht der in der Schweiz wohnhaften Ausländer ist sehr unterschiedlich geregelt. Ausländer und -innen sind in der Schweiz auf nationaler Ebene von der politischen Partizipation ganz ausgeschlossen. Da sie weder an eidgenössischen Abstimmungen noch Wahlen teilnehmen können, haben sie keine Möglichkeiten, sich durch das Stimm- und Wahlrecht aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen. Allerdings können Kantone und Gemeinden eigene Regelungen zur politischen Partizipation erlassen und somit Ausländer und Ausländerinnen das Recht gewähren, an kantonalen Urnengängen oder kommunalen Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen. Die Ausgestaltung solcher Rechte ist sehr unterschiedlich, weshalb die Möglichkeit der politischen Partizipation für Ausländer- und Ausländerinnen sehr stark von ihrem Wohnort abhängt.
Ende 2017 lag der Ausländerteil in der Wohnbevölkerung der Schweiz bei 26,8 Prozent (Quelle: Bundesamt für Statisitk). Dies wirft die Frage auf, ob es sinnvoll ist, etwa ein Viertel der Bevölkerung von der politischen Partizipation auszuschliessen. Der Ausschluss einer bestimmten Bevölkerungsgruppe von der demokratischen Mitbestimmung kann sich auch auf deren Interesse in anderen gesellschaftspolitischen Bereichen bzw. auf deren Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens auswirken. Die Diskussion über die Einführung des Stimm- und Wahlrechts auf Gemeinde- und Kantonsebene für Personen ohne Schweizer Bürgerrecht ist wird seit Mitte des 20. Jahrhunderts immer wieder geführt. In einigen Kantonen wurden bereits vor mehreren Jahrzehnten politische Rechte für Ausländer und Ausländerinnen eingeführt, während dies in anderen Kantonen (z.T. auch sehr deutlich) abgelehnt wurde. Die Kantone und die Gemeinden, die das Ausländerstimmrecht kennen, sind überwiegend in der Westschweiz zu finden. Dagegen kennen die Deutschschweiz und das Tessin kaum politische Rechte für Ausländer und Ausländerinnen. Wenn ein Ausländer oder eine Ausländerin in einer Gemeinde bzw. in einem Kanton wohnhaft ist, wo er keine politische Rechte hat, wie kann er oder sie dann etwas bewirken und die Gesellschaft mitgestalten?
In den nächsten Wochen werden wir auf der Website in-comune.ch das Thema Ausländerpartizipation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und diskutieren. Dabei handelt es sich nicht um ein Plädoyer für die Ausländerpartizipation. Vielmehr möchten wir anhand einiger Beispiele aufzeigen, welche Möglichkeiten bereits heute für Ausländer und Ausländerinnen existieren, um sich für die Gesellschaft zu engagieren und das gesellschaftliche Leben mitzugestalten, unabhängig von der Gewährung der politischen Rechte. Denn wir sind der Meinung, dass die Partizipation weit über das blosse Stimm- und Wahlrecht hinausgeht. Wir werden Projekte vorstellen und mithilfe von Good-Practice-Beispielen aufzeigen, wie die ausländische Bevölkerung ihre Anliegen in die Politik einbringen, aber auch wie sie sich für die Gesellschaft engagieren und aktiv mitwirken kann. Wir möchten auch neue Wege zeigen, wie die Beteiligung der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben erhöht werden kann bzw. wie die Möglichkeiten der Mitsprache, Mitgestaltung und Mitentscheidung verbessert werden können. Die Beispiele werden durch Blogbeiträge von verschiedenen Fachleuten, die aus der Wissenschaft oder aus der Praxis kommen, ergänzt. Damit soll die Diskussion gefördert werden.
Wir danken allen herzlich, die sich für die Partizipation einsetzen sowie allen Personen, die zu dieser Reihe beigetragen haben, und wünschen eine spannende Lektüre!
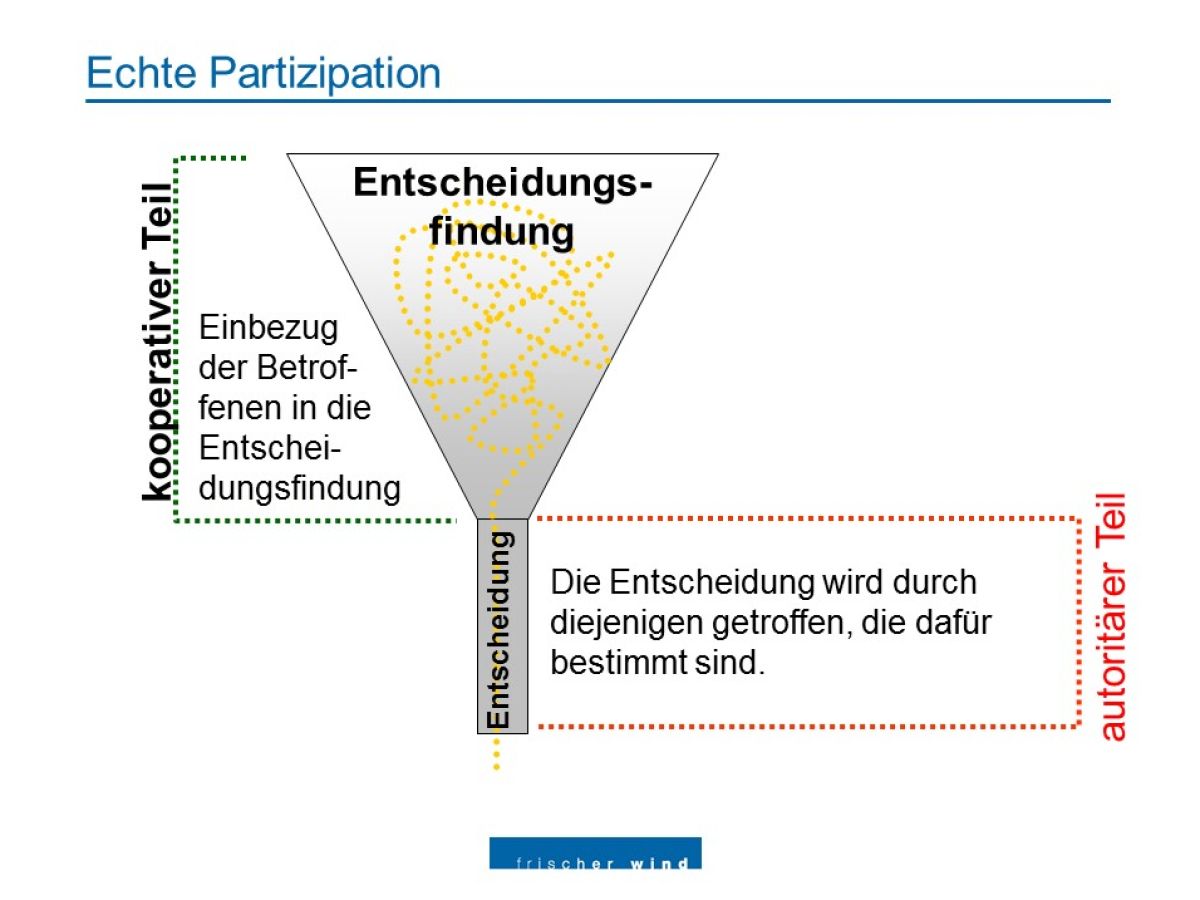
Partizipation – ein Hype und seine Folgen
Inger Kristine Schjold, frischer wind
Die informelle Mitwirkung im öffentlichen Raum boomt. Keine Strasse wird verlegt, kein Kinderspielplatz geplant und keine Fusion aufs Tapet gebracht, ohne nicht die Betroffenen in irgendeiner Art und Weise einzubeziehen. Leider kommt dabei aber ab und zu die Qualität zu kurz.
Als Teil des Beratungsunternehmens «frischer wind» begleite ich seit bald 15 Jahren partizipative Projekte – sowohl im öffentlichen Raum als auch in Organisationen. In unseren Anfängen war Partizipation ein Ausdruck, mit dem die Wenigsten etwas anfangen konnten. Inzwischen ist der Begriff in aller Munde, denn es ist heute nicht mehr denkbar, Projekte zu Fragen des Zusammenlebens im öffentlichen Raum ohne Einbezug der Bürger und Bürgerinnen alleine durch Politik, Verwaltung und Fachexperten zu bearbeiten. Partizipation trifft den Zeitgeist und scheint das Allerheilmittel zu sein, Bedürfnisse aller Interessengruppen nach Mitsprache zu befriedigen. Nicht zuletzt hoffen Politik und Verwaltung dadurch kostspielige Einspruchsverfahren und Abstimmungskämpfe zu verhindern.
Ein Begriff mit Interpretationsspielraum
Partizipation erlebt also seit einigen Jahren einen Hype. Aber wie bei jedem Hype gibt es eine Kehrseite der Medaille. In diesem Fall die inflationäre Verwendung des Begriffs Partizipation als Antwort auf alle Forderungen und Angebote zur Mitsprache. Erlauben Sie mir deshalb die Frage: Was bedeutet eigentlich Partizipation? Das Wort stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und wird mit «Teilhabe» übersetzt. So weit scheinen sich die Akteure jeweils einig zu sein. Leider erweist sich aber auch dieser Begriff in Bezug auf eine Klärung als wenig hilfreich, denn je nach Interessengruppe wird der vorhandene Interpretationsspielraum unterschiedlich genutzt. Die einen interpretieren ihre Teilhabe als Möglichkeit, etwas aktiv mitzuentscheiden, für andere wiederum ist bereits eine reine Information eine Teilhabe. Gerade bei Themen des Zusammenlebens im öffentlichen Raum kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Interessengruppen, und gerade hier ist ein gemeinsames Verständnis des Instruments, das beide Seiten zur Klärung der unterschiedlichen Interessen verwenden wollen, zentral. Lassen Sie mich an einem Beispiel aufzeigen, welche Folgen es haben kann, wenn dies nicht der Fall ist.
Wie es nicht laufen sollte
Im Rahmen eines neuen Verkehrskonzepts plant die zuständige Behörde eine neue Strasse zur Erschliessung eines Quartiers. Die Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung wollen im Lauf des Projektes auch die Partizipation der betroffenen Bevölkerung einplanen. Nachdem sie die beste Linienführung der neuen Strasse eruiert haben, führen sie deshalb eine öffentliche Informationsveranstaltung durch. In deren Nachgang regt sich jedoch unerwartet starker Widerstand gegen die präsentierte Linienführung. Die betroffene Bevölkerung wehrt sich mit Leserbriefen in der Lokalpresse, der Gründung einer Interessengemeinschaft und öffentlichen Protestveranstaltungen. Die Verantwortlichen sehen sich gezwungen, zu reagieren. Unter Einbezug der Bevölkerung sollen alternative Linienführungen geprüft werden. Die Kirche scheint wieder im Dorf, und eine konstruktive und gemeinsame Lösungssuche möglich. Bis zum Zeitpunkt, als der verantwortliche Politiker seine Vorstellungen von Partizipation erklärt: alle dürfen ihre Anliegen und Vorstellungen einbringen, aber ob davon irgendetwas im weiteren Verfahren berücksichtigt wird, lässt er völlig offen. Sie können sich unschwer vorstellen, dass das Vertrauen sowohl ins Verfahren als auch in den Politiker weg war. Bei den nächsten Wahlen wurde er abgewählt.
Das Beispiel illustriert für mich ein paar wesentliche Grundsätze, die es zu berücksichtigen gilt, will man die Vorteile der Partizipation im öffentlichen Diskurs nutzen und nicht nur einfach auf einen Hype aufspringen.
1. Partizipation muss im Gesamtprojekt von Anfang an eingeplant sein und darf nicht erst zum Schluss im Sinn eines lästigen Appendix abgehandelt werden. Lassen Sie es mich deutlich formulieren: Information ist noch keine Partizipation. Auch wenn verschiedene Handbücher und Leitfäden zur Gestaltung von partizipativen Prozessen Information immer wieder als erste Stufe der Partizipation bezeichnen.
2. Partizipation setzt einen Gestaltungsspielraum voraus. D.h. partizipative Veranstaltungen müssen vor einer Entscheidung stattfinden, also in der Phase der Entscheidungsvorbereitung. Der Gestaltungsspielraum kann grösser oder kleiner sein, aber er muss vorhanden sein. Innerhalb dieses Gestaltungsrahmens findet ein Dialog, ein gemeinsamer Meinungsbildungsprozess zwischen Projektbetroffenen und Projektverantwortlichen statt.
3. Ergebnisse der Partizipation müssen von den Entscheidungsträgern zwingend bei ihrer Entscheidung berücksichtigt werden. Das heisst nicht, dass die Ergebnisse 1:1 umgesetzt werden. Aber sie müssen ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Und wenn eine Empfehlung oder eine Idee nicht berücksichtigt wird, muss der Grund dafür nachvollziehbar erklärt werden.
Wer diese drei Aspekte konsequent befolgt, hat die wesentlichen Erfolgsfaktoren von partizipativen Prozessen im öffentlichen Raum verstanden und schafft nicht nur Vertrauen in politische Prozesse sondern auch in eines der wichtigsten Instrumente im öffentlichen Diskurs: die Partizipation.
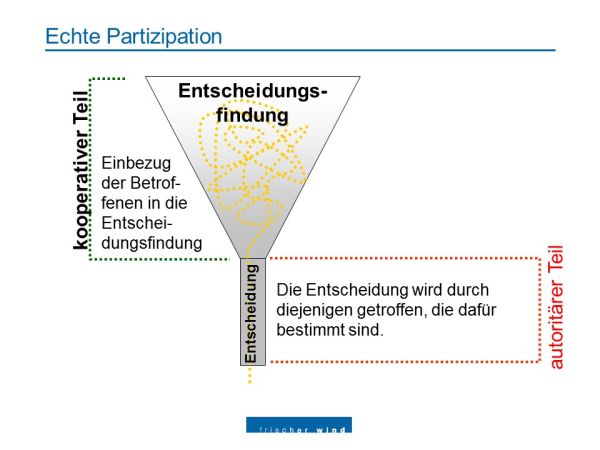
Inger Kristine Schjold, Dipl. Psychologin FH, Partnerin und Verwaltungsratspräsidentin frischer wind, AG für Organisationsentwicklungen, Winterthur
Kontakt: inger.schjold@frischerwind.com
www.frischerwind.com
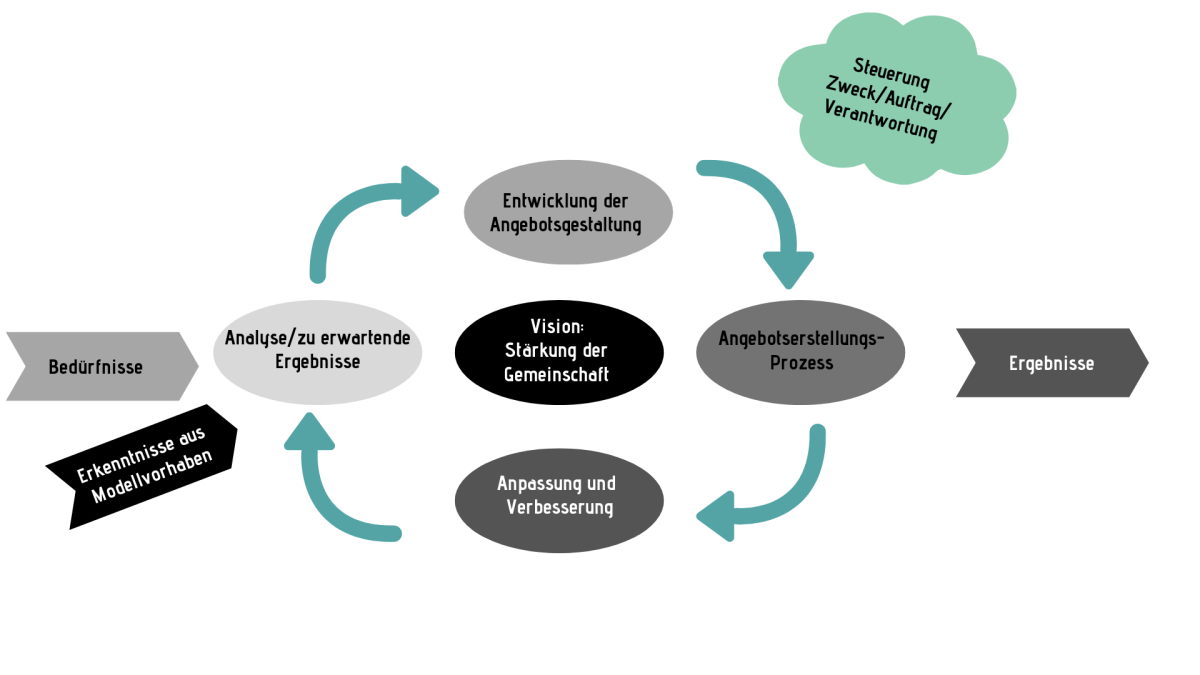
Innovativ? Ja! Und nachhaltig? – die Herausforderung für kommunale Projekte
Gastbeitrag von Jacqueline Zimmermann, Projektverantwortliche bei ProJuventute Kanton Bern
Mit Finanzhilfen für innovative Modellvorhaben zu einem bestimmten Thema fördert der Bund Projekte auf lokalen, regionalen und kantonalen Ebenen. Einerseits profitieren Gemeinden mit der Möglichkeit direkt am Projekt teilzunehmen und andererseits könnten Gemeinden die Ergebnisse der abgeschlossenen Projekte nutzen. Im Folgenden wird die Herausforderung von solchen Modellvorhaben beschrieben und aufgezeigt, wie das entwickelte Wissen aus diesen Vorhaben interessierten Kantonen und Gemeinden zugänglich gemacht werden kann.
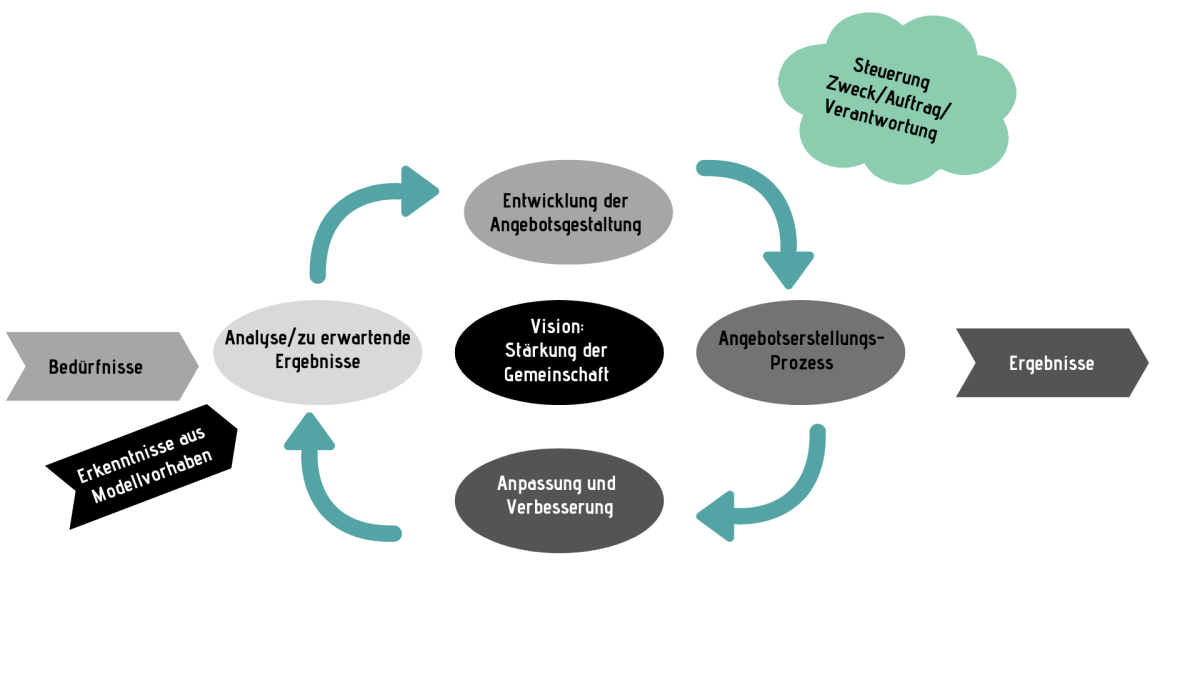
Qualitätsregelkreis: Die Politik entwickelt systematisch eine Strategie, die sie laufend überprüft, ausgerichtet auf die Vision.
Die Mitwirkung der Bevölkerung zur Stärkung der Gemeinschaft in der Gemeinde ist oft fester Bestandteil eines Gemeindeleitbildes und ein wichtiges Element bei der Auswahl eines Wohnortes. Innovative Ideen und lokale Projekte zur Stärkung des Sozialen Miteinanders sind gefragt und werden von diversen Stiftungen und Organisationen – unter anderem vom Bund – finanziell unterstützt. Dabei liegt der Fokus der Projektförderung auf dem Aspekt der Innovation. Es soll etwas Neues entstehen, gemeinnützig sein und nachhaltig wirken. Allerdings sind Unterstützungsbeiträge in der Regel auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Es sollen einerseits qualitätssichernde Ergebnisse erarbeitet werden, und andererseits sollen die Weiterführung und die Finanzierung über das Projekt hinaus sichergestellt werden.Wird ein Projekt eingereicht und eine Zusage erhalten, bedeutet dies ein grosser Glücksmoment und eine Pause in der Mittelbeschaffung. Endlich kann umgesetzt werden! Erste Ergebnisse werden - hoffentlich bald - sichtbar. Sind sie erfreulich, zeigen sie das Potenzial der Modellvorhaben auf und machen deutlich, dass eine Weiterführung erstrebenswert ist. Hier kommt die Frage nach der Nachhaltigkeit ins Spiel: Ist die Weiterführung finanziert und kann das Projekt in den laufenden Betrieb überführt werden?
Beiträge an Projektcharakter gebunden
Erneute Anfragen bei Stiftungen, Organisationen und öffentlichen Stellen machen klar: Das Projekt ist kein Projekt mehr, die Innovation ist bereits geschehen. Weitere Finanzierungen werden daher nicht geleistet. Absagen ähneln sich im Wortlaut: „weil es hier um eine Fortführung bzw. weitere Verbreitung von etwas Bestehendem geht, weniger um die Entwicklung von etwas Neuem, sind die Übereinstimmungen mit unseren Förderbedingungen nicht erfüllt.“
Das wirft die Frage auf: Wie können erfolgreiche und innovative Projektideen über die eigentliche Modellphase hinweg nachhaltig in der Gemeinde verankert respektive genutzt werden?
Einbinden in Qualitätsmanagement notwendig
Vor dem Hintergrund allgemeiner Budgetrestriktionen hinsichtlich neuer Angebote lokaler Partizipationsprozesse kann es helfen, wenn diese in ein umfassendes Qualitätsmanagement eingebunden werden. Es ist ein Anliegen der Politik, die Angebote zu überblicken und sie zu einer gemeinsamen Vision zu verpflichten: Die Stärkung der Gemeinschaft. Ähnlich wie es bei Vorgaben der Finanzhilfen von Modellvorhaben erwartet wird, können auch lokale Behörden als Geldgeber verlangen, dass Aktivitäten regelmässig evaluiert und bei Bedarf angepasst werden: Anhand eines übergeordneten Qualitätsregelkreis können sie so die vielseitigen Bedürfnisse erkennen und diese mit zielgerichteten Aktivitäten erfüllen. Als überaus wichtige Informationsquelle dienen hierbei die Erkenntnisse aus Modellvorhaben – d.h. sowohl die der bereits beteiligten Gemeinden selbst sowie die anderer Städte und Dörfer.
Laut ISO Norm* wird Qualität als „Gesamtheit von Merkmalen eines Produkts, zur Erfüllung von Forderungen von Kunden und anderer interessierten Parteien“ definiert. Kürzer und einfacher: Qualität ist, wenn Anforderungen und Bedürfnisse erfüllt werden. Dabei ist es wichtig, die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen miteinzubeziehen und laufend die Anforderungen der Bevölkerung zu überprüfen.
Qualität setzt voraus, dass alle Beteiligten ihre Bedürfnisse einbringen und gemeinsam die Entwicklung der Aktivitäten vorantreiben und mittragen können. Partizipation wird somit zum Grundelement einer wirkungsvollen Angebotsgestaltung und verkommt so nicht zur Worthülse. Bei einer breitabgestützten Beteiligung, die bereits am Anfang sichergestellt wird, besteht eine gute Chance, dass Qualität gelebt wird. Auch dazu liefern die Modellvorhaben wertvolle Aussagen, denn ohne partizipativer Entwicklungsprozess wird heute kaum mehr ein Projekt unterstützt.
Potenzial wahrnehmen: Marktplatz Innovation
Die Modellvorhaben bieten für die Gemeinden und Kantonen sehr viele Chancen, aber werden diese auch genügend genutzt?
„Quality is never an accident; it is always the result of intelligent effort“ schreibt John Ruskin. Es braucht ein intelligentes Vorgehen, um das vorhandene Wissen aus den Modellvorhaben den Gemeinden und Kantonen zugänglich zu machen. Dies auch, um die Verbreitung der Erkenntnisse aus den Modellvorhaben zu ermöglichen. Hier stellt sich jedoch die Frage der Zuständigkeit.
Eine beauftragte gut vernetzte Stelle, als Beispiel der Schweizerische Gemeindeverband, lädt zum Marktplatz der Innovation ein. Mittels dieser Austausch-Plattform können sich Gemeinden und Kantone über die neusten Entwicklungen und Ideen informieren. Dieser Austausch bietet zugleich eine niederschwellige direkte Kontaktaufnahme mit den zuständigen ProjektleiterInnen. Die Gemeinden profitieren, indem sie aus einer breiten Palette neuer getesteten Ansätze und Ideen, zielgerichtet ihre Aktivitäten einkaufen können. Damit wird nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit wirkungsvoller Modellvorhaben geleistet, sondern auch der Austausch und die Vernetzung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden werden gestärkt. Es mindert zudem die Gefahr, dass erneut ein Papier für die Schublade produziert wird.
*International Standard Organization

Stimmbeteiligung – ist weniger manchmal mehr?
Gastbeitrag von Thomas Milic (Institut für Politikwissenschaft, UZH)
Im Schnitt nimmt weniger als die Hälfte der Stimmberechtigten an eidgenössischen Urnengängen teil, bei kantonalen und lokalen Abstimmungen liegt die Beteiligungsrate in der Regel noch tiefer. Diese chronisch tiefe Partizipation wurde und wird oftmals wortreich bedauert und sie steht im Gegensatz zum Ideal der sogenannten partizipativen Demokratietheorie: Die Beteiligung aller an Volksentscheiden. Doch nicht alle teilen diese Haltung. Die Verfechter der elitären Demokratietheorie, etwa der Philosoph Joseph Schumpeter, argumentierten, dass es für das Funktionieren einer Demokratie nicht schädlich, sondern im Gegenteil gar förderlich sei, wenn sich bloss eine zahlenmässig geringe, aber hochinformierte Minderheit beteilige. Diese «elitäre» Sichtweise ist gerade in der basisdemokratischen und volksnahen Schweizer Politik wenig populär bzw. kaum jemand wagt es, sich offen zu dieser Sichtweise zu bekennen. Die Reaktionen nach eidgenössischen Urnengängen offenbaren jedoch, dass diese Sichtweise wohl weiter verbreitet ist als es den Anschein macht. Denn nach Abstimmungen argumentiert die unterlegene Seite immer wieder, dass das Elektorat zu wenig gut informiert war oder –im Endeffekt läuft auch dies auf unzureichende Informationen hinaus – bewusst irregeführt wurde. Ab und an wurden gar Wiederholungsabstimmungen gefordert, die den «falschen», weil uninformierten Entscheid korrigieren sollen. Letzteres zeigt, dass man die Legitimität eines Volksentscheids anzweifelt, wenn er auf der Grundlage ungenügender Informationen gefällt wurde.

Das Problem dabei ist: Zwischen Beteiligungshöhe und Informiertheitsgrad besteht wahrscheinlich oftmals ein negativer Zusammenhang. Klar, ideal wäre, wenn sich alle beteiligen würden und alle zugleich bestens informiert wären. Realistisch ist jedoch die Annahme, dass sich mit hoher Beteiligung die Entscheidqualität verringert. Das ist natürlich kein Naturgesetz, aber wohl häufiger als das Gegenteil davon. Man denke dabei vor allem auch an den Umstand, dass an Urnengängen oftmals über mehrere Vorlagen gleichzeitig abgestimmt wird. Wir wissen, dass die Beteiligungsrate zwischen den Vorlagen eines Urnenganges nur minim variiert, was wiederum bedeutet, dass eine erhebliche Zahl sich zu Vorlagen äussert, zu welchen sie sich nie geäussert hätte, wäre nicht gleichzeitig über eine andere, sie weitaus stärker bewegende Sachfrage befunden worden. Am besten sei anhand eines Beispiels erklärt, was dies heisst: Wer sich beispielsweise entschied, ausnahmsweise an der Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative (DSI, 28. Februar 2016) teilzunehmen, weil jene Vorlage ihn oder sie ausserordentlich bewegte, hat in der Regel auch über die restlichen drei nationalen Vorlagen befunden. Die Beteiligung zwischen der DSI (63.7%) und der Nahrungsmittelspekulation-Initiative (62.9%) unterschied sich um gerade mal 0.8 Prozentpunkte. Diese Beispielsperson hätte sich jedoch kaum an jener Vorlage beteiligt, wenn eben nicht gleichzeitig über die DSI abgestimmt worden wäre. Der Punkt ist: Es ist davon auszugehen, dass sie sich auch nicht sonderlich intensiv mit der Nahrungsmittelspekulation (oder den anderen beiden Vorlagen vom 28.2.2016) auseinandergesetzt hat, denn teilgenommen hat unsere Beispielsperson ja bloss wegen der Zugpferd-Vorlage DSI. Die hohe Beteiligung bei der DSI, so die Vermutung, könnte demnach Auswirkungen auf die Entscheidqualität der anderen drei Vorlagen gehabt haben. Schadet demnach eine hohe Beteiligung der Entscheidqualität bei Volksabstimmungen? Ich habe dies am Beispiel des Urnenganges vom 28. Februar 2016 genauer angeschaut, wo über die hochkontroverse DSI abgestimmt wurde, welche eine aussergewöhnlich hohe Beteiligung auslöste (63.7%), aber gleichzeitig auch über drei weniger konfliktreichen Vorlagen.
Zunächst aber zum Begriff Entscheidqualität. Entscheidqualität ist ein etwas unpräziser Begriff mit verschiedenen Dimensionen. Eine Dimension ist beispielsweise der Umstand, wie informiert die Stimmenden waren. Tatsächlich waren die Stimmenden bei der Nahrungsmittelspekulation, der Heiratsstrafe und der zweiten Gotthardröhre wie erwartet weniger gut informiert als bei der DSI. Aber das heisst noch nicht notwendigerweise, dass diese Stimmenden auch falsch – d.h. entgegen ihren eigentlichen Präferenzen – gestimmt haben. Die politische Kognitionsforschung hat gezeigt, dass auch dürftig informierte Wählende dank mentalen Entscheidhilfen wie zum Beispiel Parteiparolen, Regierungsempfehlungen, etc. imstande sind, einen rationalen, «richtigen» Entscheid zu fällen. Mit anderen Worten: Selbst wenn diese schlecht Informierten gut informiert gewesen wären, so hätten sie genau gleich abgestimmt. Im Prinzip ist diesen Stimmenden gar ein Kränzchen zu winden: Sie haben mit minimalem kognitivem Aufwand genau dasselbe Ziel erreicht wie Stimmende, die sich intensiv mit der Materie auseinandersetzten. Traf dies auch beim Urnengang vom 28. Februar 2016 zu? Genau das habe ich am Beispiel der Nahrungsmittelspekulation und mit Hilfe des Konzepts des «correct votings» untersucht. Dabei standen vor allem jene im Fokus, die sich primär wegen der DSI beteiligten und ansonsten kaum teilgenommen hätten. Denn diese standen, wie oben ausgeführt, am ehesten im Verdacht, die Entscheidqualität zu drücken. Dieser Verdacht ist indessen kaum begründet: Rund elf Prozent der Stimmenden stimmten bei der Nahrungsmittelspekulation gemäss meiner Erhebung falsch. Dieser Anteil ist nun bei den «Gelegenheits-Urnengänger», also jene, die sich kaum je beteiligen, aber bei der DSI für einmal zur Urne gingen, nicht viel höher. Das Ergebnis wurde im Falle der Nahrungsmittelspekulation durch die Teilnahme der «Gelegenheits-Urnengänger» nicht verfälscht. Das geht weiter auch daraus hervor, dass sich keines der drei Abstimmungsergebnisse, über die am 28. Februar 2016 neben der DSI befunden wurde, wesentlich geändert hätte, wären nur jene zur Urne gegangen, die sich auch genuin für diese Vorlage interessierten.
Eine hohe Beteiligung spült zwar auch dürftig informierte Stimmberechtigte an die Urnen, die nur wenig Interesse an jenen Sachfragen haben, die neben der Zugpferd-Vorlage auch noch vorgelegt werden. Aber sie scheinen mithilfe von allerlei mentalen Abkürzungen oftmals imstande zu sein, gleichwohl einen (halbwegs) vernünftigen, mit ihren Präferenzen übereinstimmenden Entscheid zu fällen. Mehr Beteiligung ist also auch mehr Legitimität.
Dr. Thomas Milic ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter beim Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich. Er ist auch Projektmitarbeiter am ZDA.
Kontakt
Schweizerischer Gemeindeverband
Holzikofenweg 8
Postfach
3001 Bern
Tel.: 031 380 70 00
verband(at)chgemeinden.ch
2013. Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie die «Allgemeinen rechtlichen Hinweise, Datenschutz», bevor Sie diese Website weiter benützen.